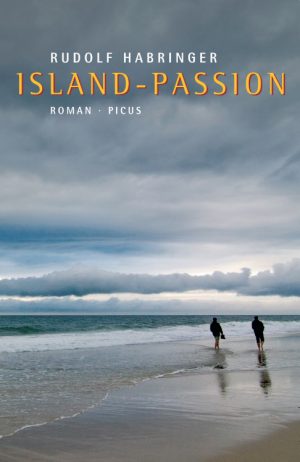Richard Behrend, Student der Musikwissenschaft und Germanistik in Wien, kommt im Jahr 1972 das erste Mal als Beobachter der Schachweltmeisterschaften nach Island. Zufällig erfährt er, dass ein Landsmann, der Musiker und Komponist Wallek, auf der Insel lebte und dort verstarb. Wallek, verheiratet mit einer Jüdin, war 1938 als Emigrant auf die Insel gekommen. Behrend recherchiert und sammelt, was immer er über Wallek erfahren kann. Er wundert sich, dass der Name in der Heimat nicht bekannt ist, und glaubt, den idealen Stoff für seine Dissertation gefunden zu haben.
Was er nicht ahnt: Die Vergangenheit ist noch allzu lebendig, die Schuldigen werden noch immer zu Opfern hochstilisiert, seine Themenwahl aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt. Immer deutlicher werden Behrend die Verstrickungen und Zusammenhänge, die zur Ablehnung des Dissertationsthemas führen.
Mit eingewoben in die Entwicklungsgeschichte sind zudem die Themen Freundschaft, Verlust und Verrat, aber auch das Exil, denn Behrend wird es ebenfalls dauerhaft auf die isländische Insel verschlagen. Die Leser begleiten Behrend über dreißig Jahre seines Lebens. Seine Entwicklung ist eine lange Reise zu sich selbst, er erkennt im Laufe der Jahre, dass er auf Island heimisch wurde. Und das unterscheidet ihn von Wallek, der seine Emigration nach dem Krieg nur zu gerne rückgängig gemacht hätte – aber in der Heimat noch immer nicht willkommen war.
Die beeindruckendsten und am besten haftenden Szenen im Roman sind die, die sich mit Wallek, mit der Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus beschäftigen. Darüber kann nicht oft genug gesprochen und berichtet werden, auch dass diese Arbeit von den Familien ausgehend geleistet werden muss. Denn nur dann, wenn klar geworden ist, dass es sehr wohl auch im eigenen Umfeld Verstrickungen gegeben hat, dass viele Familien in ihrem Kreis auch NS-Täter hatten, dass die Opfer andere und nicht sie selbst waren, nur dann ist Verarbeitung möglich:
Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Und wir sind darin verstrickt, ob wir wollen oder nicht. Es ist unserem intellektuellem Vermögen anheimgestellt, ob wir verdrängen oder uns der Vergangenheit stellen, ob wir nach dem Schluss der Debatte rufen, oder ob wir unseren Kindern und Kindeskindern begreiflich zu machen versuchen, was damals geschehen ist.
Mit diesen Worten drückt Behrends ehemaliger Freund Zollner in einem Redemanuskript von 1998 aus, was Behrend einst von ihm eingefordert hatte. Zum damaligen Zeitpunkt aber konnte Zollner dies nicht, war er nicht bereit zu akzeptieren, dass die Schuld so nahe, nämlich in der eigenen Familie liegen kann. Erst im Laufe seines Lebens war er stark genug zu erkennen, wo Aufarbeitung beginnen muss, damit sie dauerhaft ist. Dass Behrend nun einige Jahre später diese Sätze seines ehemaligen Freundes in die Hände gespielt werden, ist der mögliche Beginn einer weiteren Aufarbeitung, jener der zerbrochenen Freundschaft. Damit wird auch die Tür zu einer Versöhnung geöffnet, wird im Kleinen gespiegelt, was im Großen geschehen muss.
Die Worte Zollners sind als die Quintessenz des Romans zu betrachten, denn letztendlich trifft die Aussage über das Weiterleben der Geschichte in der Gegenwart nicht nur auf die Vergangenheit des Nationalsozialismus zu, sondern auf alles, was wir als Individuum in unserem Leben erfahren haben. Ohne die Vergangenheit sind wir in der Gegenwart nicht zu denken.