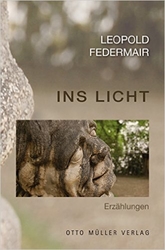Innerhalb der enfilade an Geschichten, der Flucht an verschiedenen Zimmern im Buch, kommt dieser Erzählung eine zentrale Rolle zu – finden sich in ihr all die wiederkehrenden Motive verdichtet: Spiegelungen und Wiedergänger, das Changieren von Realem und Imaginiertem, von Literatur und Leben, das Verschwinden und das Erinnern von Menschen, von Dingen. Und so wie man erst beim genauen Erkunden dieses Cafés vor Ort gewärtigt, dass es außer dem eleganten, in rotem Samt dekorierten Salon noch drei weitere Etagen umfasst, so wird man beim dritt- oder viertmaligen Lesen dieser Geschichte (sowie auch der anderen) jeweils noch neue Ebenen und Gedankengänge finden. Zugleich aber zieht es einem jedes Mal auch wenig an Boden weg; irgendetwas wird ungewiss, bleibt in Dunkel gehüllt.
Eben im legendären Zimmer trifft der Erzähler, ein bisweilen zimmernder Handwerker am Theater, unverhofft auf einen ranghöheren Kollegen, auch er ein Zimmermann, allerdings dem Familiennamen nach. Ob die beiden am Théâtre du Châtelet oder im vis-à-vis gelegenen Théâtre de la Ville engagiert sind, bleibt ungesagt; eine entscheidende Rolle jedoch spielen die den jeweiligen Prachtbauten integrierten, einander schräg gegenüber liegenden Café-Brasserien Le Mistral und Le Zimmer. In letzterer erfahren die beiden von jenem Ereignis, das als 9/11 mittlerweile längst in die Geschichte eingegangen ist; Unzählige zieht es an diesem Tag ins Mistral, über dessen Fernsehschirme wieder und wieder die Bilder der brennenden Bürotürme flimmern. So entspinnt sich erstmals ein Gespräch zwischen ihnen, wobei der Terrorangriff für den älteren, der den Gräueln des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt war, keinen grundstürzenden Schock mehr darstellt. Viel eher sind ihm die Attacken ein Anlass, vom damals selbst Erlebten zu berichten, kontrapunktiert mit den heldenhaften Grande Guerre-Geschichten seines Großvaters, der einen Kameraden aus dem gegnerischen deutschen Lager namens … Zimmermann auf kühne Weise gerettet hat. Eine weitere Gegenstimme, ein weiteres Motiv innerhalb dieser Polyphonie, in der auch Bücher „sprechen“, bildet die Auseinandersetzung des betagten französischen Theatermannes mit T. S. Eliots Langgedicht „The Waste Land“. Nicht zuletzt in der Reflexion dieser Bühnenadaptation zeigt sich die Verwobenheit persönlicher Dramen mit Ereignissen von weltumspannender Dimension.
Eine geheime Tür verbindet, wie von hier aus rückblickend deutlich wird, diese Geschichte mit der eingangs stehenden Erzählung „Aki“, die Federmair 2012 bei den Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur gelesen hatte, und die innerhalb dieses fein abgestimmten Zyklus einen – wie ich finde – völlig anderen Stellenwert erlangt, als das damalige Juryurteil ihr zugebilligt hatte. Chronologisch gesehen markiert sie den Auftakt eines Lebenswegs, der sich in seinen wesentlichen Stationen mit jenem des Autors deckt. Wir finden uns in der unguten Enge eines Jugendzimmers in einem österreichischen Landgasthaus; erzählt wird aus der Perspektive einer jungen Frau, damals Kellnerin und Akis Zimmernachbarin, die nach Jahren dem verstockten aknegesichtigten Burschen als biederem Bankangestellten begegnet, ohne dass der sie erkennt. Wilde Träume hatten den beiden einst eine Welt aufgetan, Musik hören und Musik machen füllte die Tage, über Robert Zimmermann aka Bob Dylan und andere erfanden sie sich ihr Amerika. Die Reminiszenz an eine Zeit, in der es nur Vinylplatten und Audiokassetten gab und kaum einer nicht Gitarre spielte, möchte einen heute fast melancholisch stimmen. Auch die sexuelle Irritation, die der nackt am Gang schlafwandelnde Aki in der Erzählerin evozierte, mag den einen oder die andere an ähnlich verwirrende eigene Eindrücke erinnern, und an die sprachlichen Bilder, die man in kindlichem oder jugendlichem Alter dafür fand: „der steife Schwanz mit der Erdbeere drauf, ein roter Gupf, so drall, als wollte er platzen“. – Ganz ähnliche Begriffe kamen mir in den Sinn, als ich als Fünf- oder Sechsjährige meinem Großvater beim Baden in der Wanne zugesehen habe. Nicht nur gelingt es Leopold Federmair in seinen erzählerischen Texten immer wieder, den Ton einer früheren Erlebniszeit anzustimmen, der in dem Fall wohl auch der Wortkargheit des provinziellen Milieus entspricht. Auch (ober)österreichische Dialektismen finden sich hie und da wiederbelebt. Jede Erzählung wirkt so gesehen auch wie eine Behausung für fast verschwundene Wörter und Wendungen, und für kaum noch exisitierende Dinge.
Deutlich akzentuiert wird diese Absicht vom Autor in „Talberg“, wo die Mitarbeiterin eines Fundbüros den abhandengekommenen Sachen eine Geschichte anhängt. Verloren gegangene, ausrangierte, obsolet gewordene Gegenstände werden so vor dem Vergessen bewahrt; ob Walkman oder Hirtentasche, ob „Murmeln Amulette Schmuckstücke Heiligenbildchen“, um die zeitweilig akzelerierte Schreibweise Federmairs zu zitieren – sie alle finden in dieser verschachtelten Geschichte ihr eigenes kleines Etui. Neben solchen Habseligkeiten oder zumindest Alltagsgegenständen und -praktiken, die je eng mit einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Lebensabschnitt verbunden sind, findet sich in jeder Erzählung eine bestimmte Person porträtiert, die mal mehr, mal weniger offensichtlich mit der Biografie Leopold Federmairs verbunden ist.
Dabei wirken des öfteren bekannte Werke anderer Schriftsteller konturierend. In „James Wilhelm“ wird ein Vorfall an der japanischen Literaturfakultät, an der Federmair lehrt, neuerlich aufgerollt. Jene, die mit dessen jüngsten Büchern vertraut sind, konnten bereits in anderer Form über die Entlassung eines Kollegen wegen unterstellter sexueller Übergriffe lesen. Hier nun wird das Geschehen über Heinrich von Kleists „Die Marquise von O.“ und die Literaturverfilmung Eric Rohmers bespiegelt. Anders als letztere deutet der Kleistsche Text neben der Vergewaltigungsszene nämlich auch einen inzestuösen Geschlechtsakt der Marquise an, wenn der Vater dort „lechzende Küsse […] gerade wie ein Verliebter“ auf den Mund seiner Tochter drückt. Wobei die Frivolität der Schilderung dem schwülstigen Stil geschuldet ist; zudem findet sich das entscheidende Wort „wie“ eingefügt. Der Kleist-Experte Wilhelm James dagegen scheint diese Form von Übertragungsliebe innerhalb seines pädagogischen Engagements bewusst zu ignorieren; in seinem Geheimgemach hinter dem Besprechungszimmer sucht er sich über eine weitere, eben jene sexuelle Überschreitung explizit fokussierende Filmfassung dem Stoff zu nähern, und – angeblich – der anwesenden, bei ihm Rat und Trost suchenden Studentin. Was dort nun wirklich geschehen ist, wer wen verführt hat und ob es tatsächlich zu einer Vergewaltigung kam, bleibt opak. Der springende Punkt der Geschichte ist letztlich die Frage, wie in der japanischen Gesellschaft mit dem Problem sexueller Belästigung umgegangen wird. Therapeutische Hilfe für jene, die dem Lolita-Komplex unterliegen, gibt es nicht, stattdessen abstruse Vorkehrungsmaßnahmen, wie weltferne Aufklärungsseminare, das Verbot, sich im Unterricht auf die äußere Erscheinung der Studentinnen zu beziehen oder als männlicher Lehrender in einem Prüfungszimmer bei geschlossener Tür allein mit einer Studierenden zu sitzen. Maßnahmen allesamt, die den meisten wohl eher das Leben schwer machen und größere strukturelle Fragen bewusst ignorieren, wie das aus europäischer Sicht haarsträubende Missverhältnis der Geschlechter an japanischen Universitäten, die von familiärer Seite meist unmündig gehaltenen Mädchen oder die gerade in Japan florierende Prostitution von kindlichen Girls.
Relativ nah am „wirklichen“ Leben bewegt sich auch die titelgebende Erzählung Ins Licht, die dem tragischen Inhalt zum trotz den Zyklus mit einer gewissen Zuversicht, mit Helle und Weite beschließt. Der Autor begibt sich auf Suche nach einem, den er eigentlich gar nicht recht kannte, nach Lukas, einen im Kultursektor tätigen Diplomaten und zumindest nach außen hin ziemlich leichtlebigen Mann. Vor einiger Zeit hatte er Hand an sich gelegt, nicht ohne zuvor Jean Amerys ähnlich lautende Schrift genau zu studieren. Im Abgehen der Orte lange zurückliegender, flüchtiger Begegnungen und über Recherchen aus der Ferne skizziert das erzählende Ich ein berührendes Porträt des Entschwundenen.
„Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen“ – diese Zeilen aus Andreas Gryphius’ Vanitas-Gedicht „Menschliches Elende“ werden im Klappentext des vorliegenden Bandes zitiert. So verschieden die Räume dieses metaphorischen Hauses auch sind – vom Salzburger WG-Zimmer über einen ärmlichen Verschlag in Argentinien zu einer gläsernen Bürokabine –, und so unterschiedlich die acht Geschichten in ihrer Anlage, in ihrem Grad von Poetizität auch wirken: In seiner Gesamtheit lädt das Buch ein, sich darin genau umzusehen, sich vor- und zurückzubewegen, innezuhalten, in den Spiegel zu blicken, zu reflektieren – um in den vielfachen literarischen Brechungen das ein’ oder andere von sich selbst, für sich selbst zu erkennen.