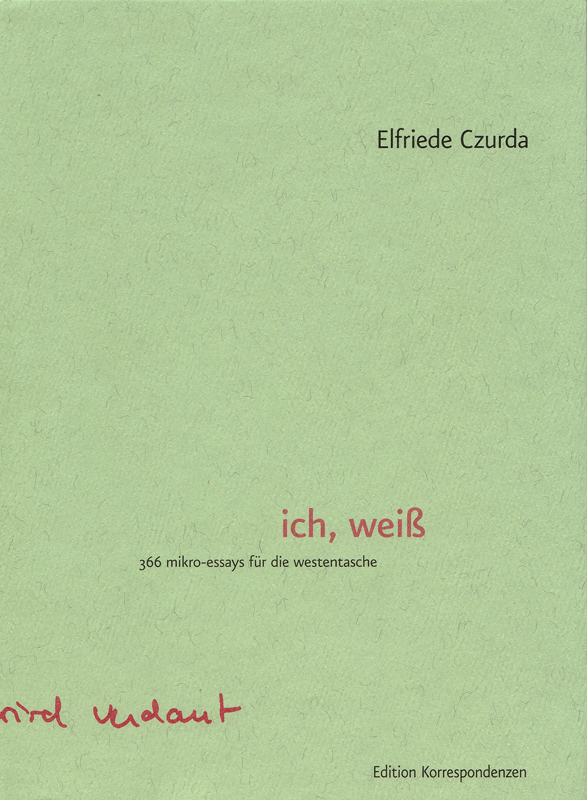Die Texte sind doppelt, aber unterschiedlich verortet und markiert: streng und diszipliniert in der Chronologie der seitlich gesetzten Datumsangaben, launig, vage, amüsiert oder verträumt in den Untertiteln, die Orten, Dingen und Tätigkeiten folgen, diese aber auch launig konterkarieren können: wie in Unterschriften zu Familienfotoalben taucht etwa eine kokette Distanzierung als „tante mathilde“ auf, oder es steht dort schlicht: „o. t.“ Die Texte sind gewissermaßen in Echtzeit geschrieben, als Improvisationen sind sie momenthafte und zustandsgebundene Kunst und bringen eine immer wieder überraschende Emotionalität zutage. Übergangsphasen wechseln mit Strängen großer Dichte, Authentizität und Nähe. Der Reiz liegt dabei in Entwicklung, Wechsel und Variation, also in der Herausforderung, gerade aus der strikten Selbstbegrenzung heraus Vielfalt und Offenheit zu gewinnen.
Der Zyklus beginnt an einem 21. Juli mit einem veritablen Seufzer; Laub/Blatt/Schrift bildet einen ersten Chiffrenhof, Kahn/Fluss/Schiff ein Metaphernfeld, Natureindrücke sind überraschend gegenwärtig in diesen kaleidoskopisch zusammengesetzten Sprachbildern. Jeder Text wirkt wie ein Akkord, ein nachhallender Cluster aus dem „halo der notierten stimmen“ (28. Juli). In den Schiffs- und Wasserbildern tauchen Bewegungen von Aufbruch und Reise auf, deren Veränderungsimpuls aber durch Krankheitsschübe wieder zurückgesetzt wird, lautmalerisch sind sie in Husten- und Schnupf-Etüden präsent. Im „fährmann“ (11. August) wird Überwindung und Übergang in ein anderes Leben bereits angedeutet, Wörter wie „entscheidung“ und „wandlung“ (11. August) verweisen auf die Notwendigkeit zu Wechsel, markieren einen langsam sich andeutenden biographischen Übergangsprozess.
Manche Texte zeigen sich als ein Inselhüpfen der Ideen und punktuellen Kontinuitäten, kreisen immer wieder in kleinen Gedankentrichtern, Flut-Licht-Himmel bildet die nächste Klangzone, ein jandlsches „auf dem land“ fällt auf (26. August), „sinnige plätzchen“ wechseln mit „klippklaren klagen“ (30. August), einem bösen Kinder- oder Auszählreim folgt eine quasi Eich’sche Inventur, serielle und permutative Elemente finden sich, die Techniken der Wiener Gruppe gebrauchen. Manchmal finden sich die Wörter gesteckt klein wie in einem Reiseschach, dann atmen sie wieder auf in Sprach- und Tonkompositionen in sekundischen Obertönen (11. September). „taub/ stumm/ tot/ lauert/ ausgelaugt“, formen sich klanglich die Glieder einer Tonkette (13. September), die sich am nächsten Tag fortsetzt in opernhaften Vokalreihen: da ist viel O. Immer wieder verlinken sich so die Texte, greifen Worte des Vortags auf, setzen fort, durchgleiten thematische Zonen, bis sie diese erschöpft haben und sich die Texte in eine neue Phase öffnen.
Immer wieder bricht ein Gefühl der Irrelevanz herein, veritable Krisen werden durchlaufen, das tägliche Tun scheint ohne Wirkung und Resultat, „der name namenlos“ (18. Mai), der Text als armes Gebilde „zwischen rhythmus und takt (…) atmet ein/ und aus“, wie ein erschöpftes Geschöpf (24. Mai). In einem Tischtennis- wie in einem Muttergedicht findet sich dagegen die selbstreferentielle vergnügliche Bezeichnung „tippmammsell“, während der 10. Juni schließt mit „schwermut als die/ mich gezeugt hat ein vater“. Der 13. Mai gewinnt Distanz, sieht das eigene Leiden mit Gelassenheit und führt in eine Art kommunistisches Manifest: „hallo ihr depressiven/ berlins und wiens ver/einigt euch hört die/ sirenen doch nicht an/ den mast gebunden an“. Der folgende Tag ist dagegen wieder skeptisch gegenüber der politisch-gesellschaftlichen Realität: „jetzt ist die diktatur so/ anonym“, dafür steht privat die lange gesuchte Entscheidung fest: „nach/ wien nach wien wohin ich will“ (15. Juli); drei Tage später vollzieht sich die Identifikation mit der Krähe auf dem Kaminblech: Unsicherheit noch bei Abheben, Lösung, Flug.
Himmel, Licht und Wolke finden in den Amsterdamer Tagen danach in einen stillen Neubeginn. Vogelflug und Wunsch, Spielzeug und Naturgedicht, Brückenmechanik im Überschreiten, das sind die Themen in den letzten Tagen, bevor am 20. Juli das Jahresbuch absetzt mit einem Text aus dem „tropenmuseum amsterdam“, der an indonesischen Effigien den Blick voraus wie zurück offen hält: Spiralig dreht sich hier der Text aus der linearen Zeit, schließt nicht nur den Jahreskreis, sondern überlappt und überschreitet ihn gewissermaßen – ein Eindruck, der sich ergibt aus dem Zufall des Schaltjahres, dem zusätzlichen 366. Tag, der den Kreis weniger abschließt als aufbiegt zur Spirale und ihn so öffnet in einen Neubeginn.