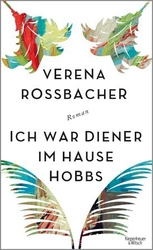Verena Rossbacher braucht in diesem Roman allerdings einen wenig agilen Protagonisten, weil sie einen üppigen Stoff zu erzählen hat. Sie verknüpft die Entdeckung der Homosexualität mit einer Kunstmarktsatire, schafft ein Porträt des Zürcher Großbürgertums und entfaltet einen fast biblisch anmutenden Reigen erst erfolgloser, denn erschreckend erfolgreicher Vateridentifikation. Die Autorin kennt das Elend des Landlebens und gestaltet dieses überzeugend aus. Feldkirch und einige Orte mehr in Vorarlberg – die Herkunft des Dieners – sind damit in der Literatur angekommen; Boten einer solchen Aufnahme in die Literatur gab es bereits einige, James Joyce, Stefan Zweig oder auch den weniger bekannten Nikolaus Martin. Als Grenze zur freien Welt war Feldkirch in mehreren Kriegen – nicht zuletzt dem Zweiten Weltkrieg – der Weg in die Befreiung, manchmal leider auch nicht.
Der Erzähler Christian Kauffmann – eben jener Diener im Hause von Jean-Pierre und Bernadette Hobbs und deren Kindern Raphael und Aurelia – vermittelt das Geschehen retrospektiv. Als fester Bestand einer dandyhaften Viererbande, die sich erfolglos den Untiefen der Pubertät zu entziehen versucht, kämpft er sich durch eine weder aufregende noch niederdrückende Jugend. Mit Olli, Gösch und Isi werden Hesse und Zweig zitiert, als wären deren Texte der Olymp der Philosophie und als wären diese vier juvenilen Denker somit die Hüter der Kultur. Zu der Erkenntnis, dass dies eben eine jugendliche Marotte war und die Manieriertheit vor allem dazu diente, die eigene Unsicherheit zu bemänteln, kommt Christian oder „Krischi“ – wie er im unvermeidbaren Vorarlberger Dialekt genannt wird – relativ früh. Für die einschneidenden anderen Erkenntnisse, die das Leben der Clique bestimmen, bedrohen und schließlich für einen von ihnen beenden, braucht er etwa 380 Seiten. Die vier Freunde sind zudem Repräsentanten unterschiedlicher Lebensentwürfe, wie sie für die 90er Jahre bis zu unserer Gegenwart exemplarisch sein könnten: Einer vegetiert in Berlin dahin, einer macht sich auf die spirituelle Suche, einer übernimmt eine Drogenberatungsstelle und einer wird eben zum blinden Knecht des Großkapitals. Üppigkeit ist eine Ingredienz dieses Erzählens, sie verdeckt gekonnt die Farblosigkeit des Erzählers. Der Schluss, dass dieser Diener – der sich erst langsam von seiner Unterwürfigkeit lossagen muss – nie wirklich aus der Provinz herausgekommen ist, ist zulässig. Sein Kosename Krischi führt bei etwas phonetischem Wagemut zum Kriecherischen und er erzählt passagenweise auch so. Schließlich spricht er Leserin und Leser per Sie an, das allein hat etwas Devotes. Weniger Geschwätzigkeit hätte seine Naivität zudem besser kaschiert. Allerdings, man kann durchaus Indizien für einen Entwicklungsroman feststellen oder wie es heutzutage eher heißt „Coming-of-Age-Roman“.
Jean-Pierre Hobbs, Familienoberhaupt und Bewahrer des Großbürgertums, stolpert im letzten Drittel des Romans über den Schwarzhandel mit Kunstwerken und wählt – als Anwalt ruiniert – den Freitod. Zumindest ist dies die erste Lesart, die der Erzähler Christian offeriert. Wie verschachtelt die Motive für den Selbstmord sind, soll nicht verraten werden, nur dass diese eng mit Fragen der Vaterschaft verknüpft sind. Dieser Plot – eine Vatersuche gleich über mehrere Generationen – ist das Prunkstück des Romans.
Stilistisch hätte man sich mehr Passagen wie diese gewünscht:
„Es war ein schlampiger Tag, einer dieser späten Nachmittage im November, die in Städten so unsortiert sind und wie fahrlässig aufgeräumt. Die Bäume wirken ausgeraubt, als hätte man sich an ihnen vergangen, Blätter hasten ziellos durch die öden Straßen, und es liegt ein Art ständiges Dräuen über der Stadt wie eine böswillig gemischte Farbe.“
So entsteht Beklemmung, die mehr über die Handelnden verrät als Bekenntnisse.
Erzählerische Details mit Raffinesse bietet das Buch einige. So ist darin der Autor John Wray zu finden, der dezidiert als solcher zu identifizieren sein soll, wobei man hier wohl eine Sachanleitung wie „jede Ähnlichkeit mit dem Autor ist unvermeidbar, führt jedoch zweifelsfrei zu falschen Schlüssen“ ergänzen müsste. Das fact-in-fiction-Konzept betrifft auch den malenden Zwillingsbruder von Jean-Pierre Hobbs, Gerome, inspiriert durch den Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, sowie den Oberbutler Robert Wenneke, Schulleiter einer Butlerschule in den Niederlanden, in welcher Christian Kauffmann das Dienen von der Pike auf gelernt hat (folgerichtig ist Christian auch ein Spießbürger), und manches mehr.
Die Autorin platziert dramaturgisch versiert – immer danach trachtend jene Kieselsteine auszustreuen, die den Lesenden sicher an das Ende des Romans führen – Vorausdeutungen und Ankündigungen. Man weiß von einer Katastrophe, aber nicht von ihrer Beschaffenheit. Suspense heißt das in mit Anglizismen durchsetztem Neudeutsch.