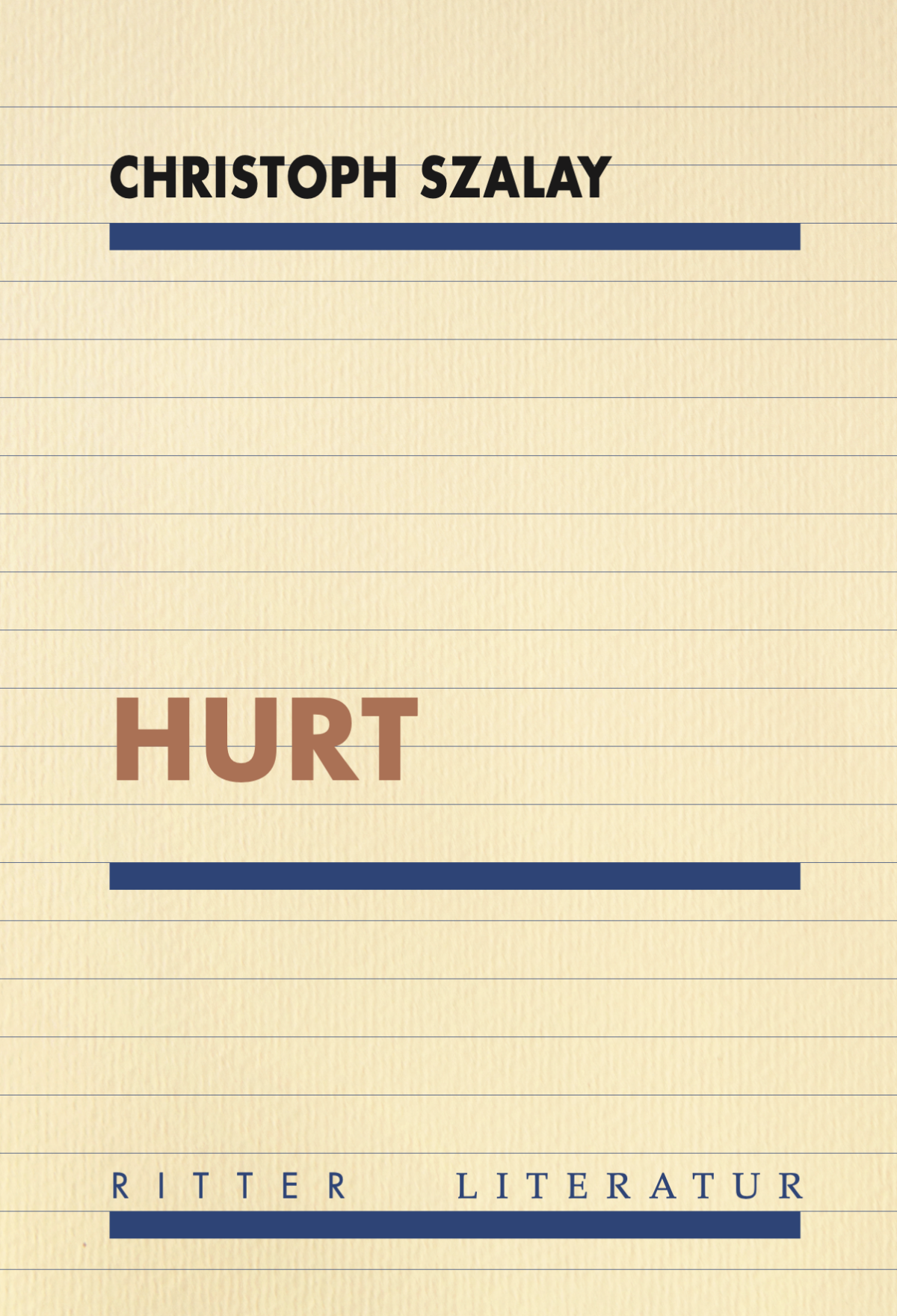Robert Musil hat einmal sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, nicht gleichzeitig im Wörthersee spazieren, schwimmen und schreiben zu können. Nicht überliefert ist, ob ihn beim Laufen oder Bergsteigen analoge Probleme gestört hätten. Notorische Nicht-Sportler wie ich sollten sich aber aus derlei Angelegenheiten sowieso besser heraushalten… Wenn nicht, ja wenn mich nicht eine gewisse Neigung und Laune umtrieben, hin und wieder wenigstens zu Büchern zu greifen, in denen körperliche Bewegungsabläufe in literarisierter Weise vermittelt werden. Wie gut es doch tut, sich etwa Haruki Murakami oder gar Alan Sillitoe ins Gedächtnis zu rufen und mit den beiden Autoren ein paar Lektürewege im Geiste zurückzugehen, die nichts an aktivistischer Frische eingebüßt haben.
Weitere Namen, die ebenfalls von einschlägiger Bedeutung sind, werden im Anhang von Christoph Szalays Hurt genannt – ein Buch, das auf den ersten Blick in besagtem Kontext steht. So fokussiert die Bewerbung auf der Rückseite des Buchs auf das „Erleben des Berglaufens“ und entfaltet im Zuge der Inhaltsangabe selbst eine solch ausgeprägte analytische Qualität, dass ein:e Rezensent:in befürchten muss, kaum mehr etwas sagen zu können, das darüber hinausginge. Was bleibt denn noch übrig? Läuft da noch etwas? Vorne, sozusagen am Start, ist man mit Wortgefügen (etwa über Aufstehen, Ankleiden, Wetterkontrollen) konfrontiert, die in erster Linie einmal sich selbst behaupten und, bruchstückhaft wie einzelne Verse, in bedächtigem Gang ein Ganzes abschreiten, das als solches nicht einfach aufs Papier gebracht werden kann. Doch die zunächst – bis auf die wenigen Worte bzw. Zeilen – fast leer bleibenden Seiten erweisen sich zunehmend als überaus eindringliche, intensive, assoziativ wirksame Lektüre, die ein anderes Zeitmaß erfordert als sonst. Dies umso mehr, sobald immer mehr Körperempfindungen und Sinneswahrnehmungen ins Spiel der beschriebenen Sensibilitäten kommen.
Das Tempo und der Umfang der Gedankenwechsel nehmen stetig zu, es geht sehr wohl vorwärts und um die Verschiedenheit von Geländeformationen und Umweltfaktoren, in denen sich die große Erdgeschichte eingeschrieben hat, bis in kleinste Schattengebilde hinein. Da und dort streift nun Christoph Szalay an Geschichten, stolpert geradezu über Narrative, die bis heute die geologische Vergangenheit spiegeln, und positioniert das in der Literatur fiktionalisierte Laufen als eine Metapher, vieldeutig wie jedes andere Motiv, offen für Interpretationen. Hervortritt, mittlerweile in immer ausführlicheren Textpassagen, die Reflexion einer metaphysischen Selbstenthebung, einer Entrückung von situativen, empirischen Rahmenbedingungen zugunsten eines transformativen (vgl. S. 89) ‚anderen Zustands‘, wie es – einmal mehr – Robert Musil wohl ausgedrückt hätte, um psychophysische Konstitutionen des Menschseins sowohl zu vergegenwärtigen als auch zu mythologisieren.
Szalay ist auf durchaus vergleichbaren Pfaden unterwegs. Paradoxien (vgl. S. 88), bestehend aus Analogien und Gegenüberstellungen, aus wortmagischen und philosophischen Exkursen, erweisen sich dabei als Kernelemente seiner Poetologie. Wirklichkeit wird wahrnehmbar als eine Art von performativem Setting, das sich anzubieten scheint für körperhafte Betätigungen, wie in einem Traum. Die ästhetische Unmittelbarkeit der Atmosphäre, die das Buch entwickelt, hebt es deutlich ab von, um ein Beispiel zu nennen, sportiven Trainingsratgebern, die aus demselben Thema meist nicht viel mehr als ein Brevier zum Nachbeten stereotyper Handlungsanweisungen machen.
Dazu kommt noch, dass Szalay seine Ausführungen mit Hinweisen und Bemerkungen zu Schmerzerfahrungen (vgl. S. 92) kombiniert, die einen gewissen autobiografischen Ton in die Textur einbringen und, nicht zuletzt, den Buchtitel erklärbar machen. Denn da entwirft ein Autor nicht bloß ein Gegenmodell zur Alltäglichkeit, sondern betreibt unterschwellig individuelle Erinnerungsarbeit, um eine schwierige Lebensphase zu bewältigen.
Daran Anteil nehmen zu können und mit Hilfe einer Fülle von Erzählungen, (mehrsprachigen) Zitaten, Kommentaren, tabellarischen Vitalparametern und enigmatischen Visualisierungen (von Sarah Sternat) eines weiten Horizonts intellektueller Beweglichkeit gewahr zu werden, führt zu einem außergewöhnlichen, experimentell anmutenden, doch im Grunde stilsicher umgesetzten Stück Sprachkunst. Da hat der ‚blurb‘ auf der Rückseite des Bands keineswegs zu viel versprochen.
Arno Rußegger, ao. Univ.-Prof. i.R., Studium der Germanistik und Anglistik, verbrachte seine wissenschaftliche Laufbahn zunächst am Robert-Musil-Institut für Literaturforschung / Kärntner Literaturarchiv, danach (ab 2009) am Institut für Germanistik der Universität Klagenfurt. Dissertation über Robert Musil, Habilitation (2004) zum Thema Selbstbezüglichkeiten in Literatur und Film. Forschungs-, Lehr- und Publikationstätigkeit mit folgenden Schwerpunkten: Österreichische Literatur seit 1900, intermediale Literatur, Filmanalyse, Kinder- und Jugendliteratur, angewandte Germanistik (Buchforschung, Literaturvermittlung, Literaturbetrieb). Buchpublikationen: als Hrsg. [gemeinsam mit Ulrike Krieg-Holz]: Österreichbilder. Mediale Konstruktionen aus Eigen- und Fremdperspektive. Marburg 2022; als Hrsg. [gemeinsam mit Gottfried Schlemmer und Georg Seeßlen]: Hans Moser. Wiener Weltschmerzkomiker. Wien 2020; als Hrsg. [gemeinsam mit Andreas Peterjan]: Neo-Phantastik. Wien 2018 (= libri liberorum, Heft 49; als Hrsg. [gemeinsam mit Angela Fabris und Jörg Helbig]: Horror-Kultfilme. Marburg 2017.