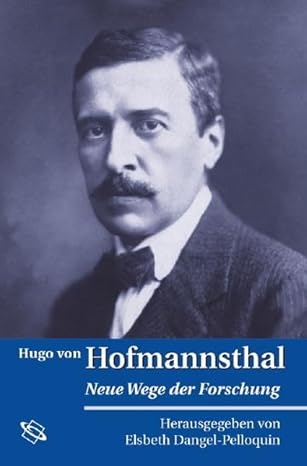Zehn zwischen 1991 und 2005 erstmals erschienene Beiträge vermessen und leuchten den weiten Raum des Hofmannsthalschen Oeuvres aus. Sie können sich dabei auf die rezenten Fortschritte in der Editions-, Überlieferungs- und Rezeptionslage im Zuge der neuen Kritischen Werkausgabe stützen sowie auf zeitgemäße, aktuelle theoretische Perspektivierungen, wobei der Fokus „auf die Genderstruktur der Texte, auf semiotische und kulturwissenschaftliche Ansätze“ (S. 8), so die Herausgeberin in ihrer kundigen, aber auch recht knapp gehaltenen Einleitung, gesetzt worden ist. Dass eine vergleichsweise schmale Auswahl aus der Forschungsliteratur großen Mut zu Synthesen wie zu Auslassungen erfordert, dass Manches nur im Kontext angesprochen werden kann und der eine oder der andere Beitrag doch fehlt, liegt auf der Hand. Auf einige neuere Monographien (z. B. jene von Christoph König, Timo Günther und Heinz Hiebler), die in den Band nicht Eingang finden konnten, wird denn auch kurz verwiesen, zwei weitere, unerwähnt gebliebene, dürfen hier zumindest nachträglich in Erinnerung gerufen werden: Robert Vilains einlässige Studie The Poetry of Hugo v. Hofmannsthal and French Symbolism (2000) sowie Marie Luise Wandruszkas typologisch ausgerichtete und vom Genderaspekt her interessante Arbeit Der Abenteurer und die Sängerin (2005).
Hofmannsthal in seiner „pointiert modernen Ästhetik“ (S. 9) zu zeigen und dies vor allem an Texten der mittleren Schaffensperiode (seit Ende der 1890er Jahre) vor- bzw. auszuführen, ist das deklarierte Anliegen, das Dangel-Pelloquin im und mit dem neuen WdF-Band im Auge hat; ihm ist die (im Band chronologisch, d.h. nach dem Veröffentlichungsjahr angeordnete) Auswahl der Beiträge sowie die zunächst schwer erkennbare und dennoch sich herauskristallisierende Schwerpunktbildung verpflichtet. Die ‚Rätselhaftigkeit‘ der Reitergeschichte, der sich Rüdiger Steinlein widmet, bildet den Auftakt der Beiträge und gibt das Reflexionsniveau vor. Auf die Freilegung von ‚verschwiegenen‘ Strukturmerkmalen, d. h. in der Folge auf Diskurse des Begehrens und der Gewalt, durch welche die „Matrix des Ödipus“ schimmere (S. 23), kommt es Steinlein dabei an. Unterhalb eines auf der Textoberfläche ablaufenden, präzise verorteten und dennoch streckenweise in diffuses Licht getauchten militärisch-hierarchischen Konflikts mit problematischen Inszenierungen und Phantasien vom Erobernd-Männlichen einerseits und einem lockend-schmutzigen Weiblichen andrerseits entfalte sich, so Steinlein, das Drama des Wachtmeisters Lerch als das eines vergeblichen Kampfes einer psychisch destabilisierten Sohn-Instanz um väterliche Anerkennung. Die finale, bündig enggeführte Opferung dieses die herrschenden Codes nicht erkennenden Sohnes führt Steinlein weniger auf das klassische Rivalitätsparadigma zurück; vielmehr deutet er sie als „manifeste[n] Ausdruck des umfassenderen Auflösungsprozesses einer ganzen soziosymbolisichen Ordnung“ (S. 34), in die sich durch die radikale Entsorgung des Opfers am Textende, d.h. ihr wortloses Verschwinden im weitergehenden Text, Spuren autobiographischer Selbstreflexion eingeschrieben hätten, welche das Frühwerk an markanten Wegmarken so augenfällig kenn- und auszeichne.
Gabriele Brandstetter führt in ihrem Beitrag über Hofmannthals Ästhetik des Schöpferischen als Traum vom anderen Tanz die einleitend angedeutete „pointiert moderne Ästhetik“ (S. 9) aus, welche den Autor nach seiner Chandos-Krise als keineswegs müden, desillusionierten und von daher zum Lustspielhaften und Erprobten neigenden Textproduzenten zeige. Am Dialog Furcht, einem Gespräch der beiden Tänzerinnen/Hetären Hymnis und Laidion, habe Hofmannsthal vielmehr auf knappen, verdichteten Raum kühn den Mimesis-gesteuerten Kultur- und Dichtungsbegriff thematisiert und aufgebrochen, indem er jene perfekt verinnerlichte und abrufbare „Tradition von Inspirationstheorien“, wo Literatur als „Reservoir von Literatur aus Literatur“ (S. 57) modelliert werde, zugunsten einer die Schranken der Kultur aufsprengenden archaischen Körperlichkeit de(kon)struiert und die Vision mystisch-magischer Vereinigung mit dem Selbst in Gestalt des unstrukturierten Tanzes als Fruchtbarkeitsritual skizziert. Während Hymnis in ihrem Tanz und ihrer Argumentation das Prinzip der klassischen Kunst als mimetische Inszenierung vorgegebener Mythen und damit die Regelhaftigkeit und Perfektion klassischer Bildung zum Ausdruck bringt, durchbricht Laidion diese durch ihr Sich Versenken in den ‚barbarischen‘, auf ekstatische Gestik und Sexualität ausgerichteten Tanz, der keine Mimesis und damit auch Disziplinierung, sondern völlige Entgrenzung und Wiedergewinnung von Körperlichkeit anvisiert – eine Bewegung, die Hofmannsthal neue Dimensionen des Schöpferischen aufgeschlossen habe.
Vom Ansatz her verwandt, d. h. das antike „Paradigma des Kultischen“ (S. 105) aufgreifend, aber um neurotisch-hysterische Erkenntnisse und Strategien anreichernd bzw. brechend, zeigt Juliane Vogel in ihrer Elektra-Deutung, wie intensiv sich Hofmannsthal mit zeitgenössischen Diskursen und Texten auseinandergesetzt hat und zwar mit Erwin Rhodes religionsgeschichtlicher Studie Psyche (1891/94) und Freud/Breuers Studien über Hysterie (1895), welche die „oszillierenden Pole“ einer von Maladie nerveuse und antiker Kultpraxis geprägten Bearbeitung der sophokleischen Vorlage mit dem Fluchtpunkt ekstatischer Zertrümmerung bzw. Erstarrung bilden. Elektra stelle sich dabei „ihrem Autor zuweilen wie ein weibliches Double gegenüber“ (S. 115), womit der Gestus des Ekstatisch-Hysterischen nicht mehr als defiziente, analysebedürftige sondern als poetische Strategie in den Blick genommen wird. Vogels Beitrag markiert denn auch deutlich die Differenz zu älteren, etwa zu jenem von G. Baumann im WdF-Band (1968), in dem an Stelle einer präzisen Freilegung der verschiedenen Diskursstränge Hofmannsthals Projekt suggestiv und zugleich unverbindlich als „ergreifende Gebärde des Ausweglosen und Unvereinbaren“ und Elektras finale, an hysterische Tanzgebärden erinnernde Erstarrung noch als Versöhnung der „Verlorene[n] mit ihrem Ursprung“ (S. 310) gelesen wird.
Mit einem Elektra-Zitat leitet auch David E. Wellbery seine feinsinnige Analyse zum Chandos-Brief ein, die eine Gemeinsamkeit von drei Denkfiguren zwischen Hofmannsthal und Schopenhauer (zu dessen Einfluss auf die moderne Literatur Wellbery bereits 1998 eine lesenswerte Studie vorgelegt hat) zum Ausgangspunkt nimmt: die Belanglosigkeit der Dinge im Hinblick auf ihre ästhetische Erfahrbarkeit, welche H. weiter zuspitze; die in ein „Bildfeld des Strömens und Fließens“ gefasste ‚Subjekt-Objekt Fusion‘ sowie die besondere Zeitebene, d.h. eine „Gleichzeitigkeit, in die sowohl Vergangenheit als auch Zukunft eingehen“ (S. 190f.) ohne als solche eigens markiert zu werden. Dem folgt eine Analyse der narrativen Struktur, die zur eigentlichen Frage und Herausforderung überleitet, nämlich zu jener nach dem besonderen Verhältnis zwischen den a prima vista als semantisches Material „nichtssagendsten Sätzen des Textes“ (S. 197), der „Laktopoetik“ am Textbeginn, und der verstörenden Faszination der diesen Sätzen inhärenten und schrittweise durchbrechenden Bildlichkeit. In der „Evokation des Opfers“ (im Chandos-Brief den grausamen Tod der Ratten betreffend, erweitert um die Widder-Schlachtungsszene im Gespräch über Gedichte) erkennt und bestimmt Wellbery den ’sakrifiziellen‘ Ursprung dieser frühen Poetologie, in dem jene Augenblicke passieren, und zwar im archaisch-gewaltgetränkten Vorgang der Opferung, in denen das Subjekt „die Gegenwart des Unendlichen durchschauert“ (S. 205) und im Zucken einen Schimmer des Unendlichen zu erfahren vermeint. Im abschließenden „Deutungsversuch“, der zeitgenössische Relativitätsdiskurse (Nietzsche, Simmel) mit einbezieht, skizziert dieser Beitrag eine subtile, über die gängige Sprachkrisendiagnostik hinausweisende Analyse einer ästhetischen (Epochen)Signatur, in der „die Fokussierung der absoluten Verlassenheit“, die Reduktion auf „das nackte Leben in seiner Sprachlosigkeit“ zur Erschütterung des Ich in seiner „kulturell vermittelten Identität“ führt und zugleich durch die Somatisierung eine affektbesetzte Freisetzung von Textkörpern zelebriert.
Mit einer ausgreifenden Analyse des Andreas-Fragments und der poetologischen Verortung desselben im Werkkontext bzw. in einer bis in die (Früh)Romantik (K. Ph. Moritz, E. Mörike) zurückblendenden Traditionsverkettung durch Mathias Mayer findet die Schwerpunktsetzung des Bandes auf die mittlere Schaffensperiode Hofmannsthals sowie auf Texte, an denen dezidiert ästhetisch-poetologische Verfahren ins Zentrum treten bzw. reformuliert werden, ihre robuste Kontur. Drei sind die Hauptthesen, die Mayer dabei entwickelt: die Idee, den Text als Roman der Desintegration in bewusster Absetzung von der Bildungsidee-Tradition zu sehen, die Öffnung der Grenzen des Ich (Spaltungsphänomene und deren Herleitung von M. Prince, was freilich auch schon Alewyn angedeutet hat) sowie den „Charakter einer Matrix“ (S. 77), die sowohl auf das Frühwerk zurückblende als auch spätere Texte vorwegnehme, wobei sich dies vor allem auf Aspekte der Spaltungs- und Desintegrationsphänomene beziehe.
Einer anderen ‚Matrix‘ ist der Beitrag von Konrad Heuman auf der Spur, und zwar den Wirkungen der sehr profanen Außenwelt in ihrer Phänomenologie aus Landschaft, Licht und jahreszeitlichen Erscheinungen auf das Innere, auf die Produktionskraft des Autors. Die genauen, von Werkkenntnis zeugenden Beobachtungen und Verweise lassen dennoch Zweifel aufkommen, ob eine in Briefen geäußerte Abhängigkeit Hofmannsthals von solchen Inspirationsquellen gleich als „möglicher Ausgangspunkt seiner Theorie des Schöpferischen“ (S. 140) definiert werden kann.
Mit Lyrik beschäftigt sich – ein wenig überraschend – nur ein Beitrag: Gerhard Neumann widmet sich dem merkwürdigen Lebenslied(1896), das er über die auffällige „Gebärde der Verschwendung und des Verströmens“ (S. 91) als einen frühen Entwurf einer Poetik des Visionären liest, d. h. auch als Versuch, die traditionellen Grenzen des kulturellen Wissens zu überschreiten, also Sprache durch andere Ausdrucksformen zu ersetzen. Gegen den frühen Gestus einer geradezu „maßlose[n] Aufnahme des Überlieferten, setze Hofmannsthal als subversiven und „eigentlich poetischen Akt“ (S. 92) jenes Verströmen und Vergeuden, jene „aromatische Entgrenzung“ (ebda), wie dies im ‚Salböl‘ fühlbar werde, – eine Ästhetik des Flüchtigen, die sich als Baustein in die Recherche nach ausdrucksorientierten Gegenentwürfen zur Tradition in den Jahren um und nach dem Chandos-Brief einfüge.
Zwei Beiträge wenden sich schließlich dem dramatischen Werk zu, das hier auf dem ersten Blick auf die Form der Komödie zugespitzt aufscheint. Allerdings ist die Komödie schon bei Hofmannsthal, aber auch bei den Beiträgen von Ursula Renner und Inka Mülder-Bach ein tendenziell weites Feld, auf dem unter dem paarfigurigen Grundschema, dem Rollendesign der Form und ihrer theatralischen Ausstaffierung, mitunter weit dramatischere Diskurse nisten als sie gewöhnlich der Komödie eigen sind oder ihr zugestanden werden.
Ausgehend von der Korrespondenz des jungen Hofmannsthal mit der über siebzigjährigen Josephine von Wertheimstein und der darin aufblitzenden subtilen „Grenzüberschreitungen“ unternimmt z. B. Renner eine Auslotung der „Spielräume der Imagination“ (S. 146), die sich aus der Briefbeziehung hin in die Rosenkavalier-Komödie und deren Inszenierung von Geschlechterrollen weiterdenken lasse. Dabei komme dem Paarlauf aus dem Fundus der Operette der Charakter eines subtil von der Marschallin eingefädelten „joint venture aus Tradition und Moderne“ (S. 149) zu, bei dem die Marschallin als herausragende Frauengestalt souverän eine Position der Macht besetzt, normierende erotische Geschlechterordnungen durchkreuzt, am Ende diese aber melancholisch in eine prästabilierte Matrix wieder einmünden lässt.
Auch die Lesart, die Inka Mülder-Bach zum Schwierigen vorschlägt, wirkt zunächst überraschend, ist aber zugleich anregend und überzeugend durchargumentiert. Was den frühen Stimmen der Kritik als „Totentanz wohlparfümierter Drohnen“ (Jacobsohn, 164) und späteren vielfach als einer der Begründungstexte des ‚habsburgischen Mythos‘ gegolten hat, wird von ihr gerade in der vermeintlichen Geschichtsverweigerung als tief der historischen Schockerfahrung des Krieges verpflichtet und diese reflektierend begriffen. In der Figur des Hans Karl Bühl entwerfe Hofmannsthal, so ihre These, auch den traumatisierten Menschen, eine „programmatische Gegenfigur zu dem wehrhaften modernen Anthropos, der in den Materialschlachten geschmiedet werden sollte“ (S. 168). Der ‚Schwierige‘ stehe insofern für den Typus des durch den Krieg verschütteten ‚männlichen Hysterikers‘, der am Übergang ins zivile Nachkriegs-Leben laboriert und daher zwangsläufig ins Komische geraten muss mit seiner (auch habituellen) Desorientierung und den nur scheinbar absichtslosen Versprechern, die zugleich einen psychoanalytisch lesbaren und theatralisch hervorragend umsetzbaren Prozess einer Re-Integration ins Soziale ermöglichen.
Die historischen Paradoxien – die Komödie spielt im Kriegsjahr 1917 und setzt diesen als beendet voraus, lässt aber die politisch-sozialen Strukturen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung 1920/21de facto abgedankt hatten, weiterleben – fungieren einerseits komplementär zu jener ‚Schatten-Wirklichkeit‘, welche Neuhoff, Exponent deutscher Stahlgewitterrhetorik, irritiert wie um Verständnis ringend wahrnimmt. Andererseits koppeln sie die Fehlleistungen im Privaten an die durch das Verschüttungstrauma konditionierte Diskontinuität, welche erst durch die „komische Kur“ in jenes mildere Licht zurückführt, das sich im Glauben, sich doch mit Helene verlobt zu haben, zwar keinen erotischen Lorbeer flechten, aber doch eine Art Versöhnung mit sich und den Ansprüchen des Geschlechts davontragen kann. Eine bizarre freilich fast mehr noch als eine komische, wie Stani am Ende des Stückes erstaunt über die ausbleibende Umarmung räsonierend meint: „das verlobte Paar [ist] zu bizarr, um sich an diese Formen zu halten.“
Als Resümee kann festgehalten werden, dass die im Band enthaltenen Beiträge das von der Herausgeberin in Aussicht gestellte ‚pointiert moderne‘ Hofmannsthal-Bild vielfältig anvisieren und auch einzulösen vermögen. Durchwegs sind hier bestens ausgewiesene und an innovativen Zugängen interessierte Hofmannsthal-Kennerinnen und Kenner am Wort. Insofern ist der Herausgeberin mit diesem Band eine anregende und wegweisende Zwischenbilanz der neueren Hofmannsthal-Forschung gelungen.
Dass diese durchaus gelungene, dem avancierten Diskurs- und Diskussionsstand Rechnung tragenden Auswahl von Analysen trotz ihrer ins Strukturelle zielenden Ansätze, ihrer aufschlussreichen intratextuellen Verknüpfungen und intertextuellen Referenzen wichtige Textkorpora Hofmannsthals (unbeabsichtigt) in den Hintergrund treten läßt und sich deshalb (eigentlich unnötig) dem leisen Vorwurf des Schlaglichtartigen auszusetzen riskiert, muss freilich am Ende angemerkt werden. So hätte man doch auch gern über die lyrischen Dramen Neueres gelesen, über Hofmannsthals lange Auseinandersetzung mit der Ödipus-Thematik, mit dem Venedig-Casanova-Stoff, aber auch mit dem französischen Lustspiel (Molière u.a.), über sein Interesse dem Film gegenüber und performativen Experimenten (Pantomimen und Sketches) sowie über das weite Feld seiner kulturpolitischen Reflexionen, die durch Briefeditionen, aber auch neues Material im Kontext einzelner Werkprojekte in den letzten zwanzig Jahren besser erschlossen worden sind. Einen um rund fünfzig oder sechzig Seiten erweiterten Umfang hätte sich der Verlag bei einem Unternehmen wie dem vorliegenden durchaus leisten können, ja müssen.
Reizvoll wäre es auch gewesen, die im Hofmannsthal-Jahrbuch 2003 zum Abdruck gelangten poetischen Nachklänge zum Chandos-Brief von Elfriede Czurda, Friederike Mayröcker und Peter Waterhouse als Rezeptionsdokumente besonderer Art zu integrieren, um sie einem doch breiteren LeserInnenkreis zugänglich zu machen.