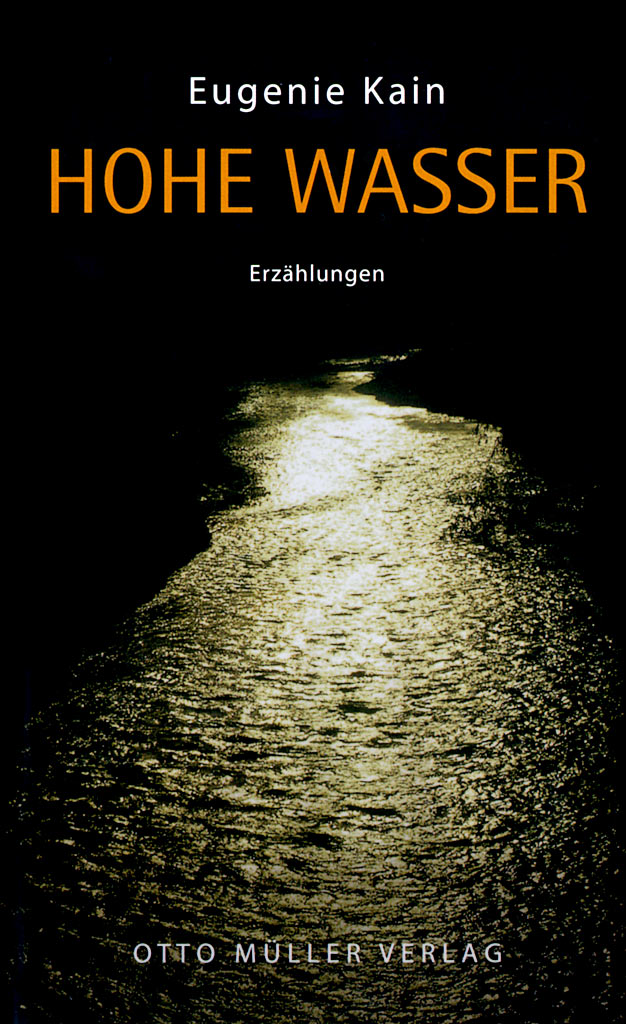Sieben Erzählungen von Figuren, die es zum Wasser zieht, denen das Wasser aber auch bis zum Hals steht: Verlierer, Arbeitslose, Verlassene, Überforderte, Ausgeschundene.
In der ersten Erzählung ist von einem AMS-Mitarbeiter die Rede, der im kalten Herbst durch Südböhmen radelt, um seine alte Liebe zu finden, nachdem er von seiner Familie verlassen wurde. Einer, der durch seine Arbeit das Mitgefühl verloren hat: „Die Gesichter sind mir abhanden gekommen. Genauer gesagt, das, was sie einzigartig macht. Die Lachfalten, die Sorgenfalten, das Grübchen am Kinn, der weiche Zug um den Mund, die fröhlichen Augenwinkel. Ich sehe Kerben in der Landschaft und Falten in der Zeit, aber nicht mehr in den Gesichtern.“
In der nächsten Geschichte erzählt Kain aus der Sicht der Enkelin vom Sterben der alten Großmutter, die im Krankenbett nach Wasser schreit. Ebenfalls aus der Perspektive eines Kindes ist die Erzählung Acqua Alta geschrieben. Ein Kind fährt mit einem befreundeten Ehepaar nach Venedig, um das Hochwasser zu bestaunen. Daheim ist die Familie in die Brüche gegangen, ist die alkoholabhängige Mutter auf Entzug, der Vater mit dem Bruder über alle Berge.
In Unterhillinglah erzählt sie von einer jungen Mutter, die im neugebauten Haus mit ihrem neugeborenen Kind versauert: „Mit fauchendem Bug kämpfte sie sich durch zähe, feuchte Tage. Es gelang ihr nicht mehr, aus dem Wellental herauszukommen. Sie kam auf halbe Höhe des Wellenberges, ein kurzer Blick auf Wellenkämme und auf Gischt, dann ging es wieder in die Tiefe.“
Beeindruckend, aber unheimlich trist ist die Erzählung „Kaventsmann“: Eine Frau versucht bei einem Revival-Urlaub in Irland die Liebe ihres Ehemannes zurückzugewinnen. Er liebt sie einfach nicht mehr, will Distanz, sie aber versteht nicht und überfordert ihn erst recht: „Du drückst mir die Luft ab, sagte er, und sie verstand nicht.“ Während er über Freak Waves, plötzlich und unerklärlich auftretende Monsterwellen, liest, versucht sie mit aller Gewalt, ihm Gefühle herauszulocken. „Es gab keine andere Frau. Es gab keinen Anlass. Er war nur eines Morgens aufgewacht, und die Dinge hatten sich verändert.“ Die Liebe ist erlöscht. „Manchmal dachte er, hoffentlich geht sie mit den Kindern anders um … Bei jedem Griff in die Lade mit den Süßigkeiten musste um Erlaubnis gefragt werden, das Essen war eine Aneinanderreihung von Ermahnungen und Drohungen, und trotzdem fiel das Wasserglas um oder ein Stuhl kippte. Die Ordnung im Kinderzimmer war ein Problem, das für die Frau zum Zweitagesgespräch ausarten konnte. Er war verblüfft, welche Veränderung mit ihr vor sich gegangen war. Plötzlich stand eine Fremde in seiner Küche, plötzlich lag eine Fremde in seinem Bett.“ Als sie in einem romantischen Moment auf ihn zuläuft, stürzt sie und schlägt sich die Vorderzähne aus, wird sie ihrer ganzen brutalen körperlichen Lächerlichkeit preisgegeben. Keine spektakuläre Geschichte, eine traurige, die tausendfach vorkommt, das plötzliche und unerklärliche Erkalten einer Liebe. Wie die Autorin aber diese unspektakuläre Geschichte erzählt, leise und psychologisch stringent, ist spektakulär. Mit sparsamsten Mitteln erreicht sie eine Eindringlichkeit, die kaum zu übertreffen ist.
In Feuerbrand ist von einer Alleinerzieherin die Rede, die mit ihren zwei Kindern in der Bretagne auf Urlaub ist. Weil sie nicht reserviert hat und kaum ein Zimmer frei ist, ist sie ständig auf Herbergsuche, das Gepäck ist schwer, die Kinder lästig. Überforderung statt Erholung. Die Beziehung zu ihren Kindern – ein Tabu in unserer Gesellschaft – ist schlecht. Als ihr Sohn sie erschrickt, entladen sich ihre Aggressionen, sie schlägt auf ihn ein: „Warum tut ihr das, schrie sie die Kinder an, warum erschreckt ihr mich, warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? – Du warst schon wieder ganz weit weg mit deinem Kopf, sagte der Sohn.“ Ein symptomatischer Satz für die Figuren: Sie wollen ihrem Leben entfliehen, wollen weit weg und verheddern sich doch nur in ihren Problemen, wie eine Schiffsschraube, um die sich Algen geschlungen haben.
Kain verschränkt Erzählstränge, lässt sie parallel laufen. Manche Figuren tauchen in mehreren Geschichten auf. Der Ton der Erzählungen ist nüchtern, trotzdem stehen sich Erzähler und Figuren nicht distanziert gegenüber.
Die sieben Erzählungen sind Geschichten aus dem wirklichen Leben, dem alltäglichen, mühsamen, und darum sind sie wichtig. Dass sie so realitätsnah gelungen sind, mag auch darauf zurückzuführen sein, dass Kain ihre Erfahrungen als Beraterin im Sozialbereich genutzt hat, Literatur und Leben eine fruchtbringende Symbiose eingegangen sind.
In der letzten Geschichte erzählt sie von einer Einlegearbeiterin – im Winter Fische, im Sommer Gemüse -, der die ständige Feuchte die Hände ruiniert hat. Auch sie eine Verliererin, auch sie kommt vom Wasser nicht los, zieht von einem feuchten Loch ins andere, weil sie der Donau, die ihr die Sicherheit gibt, dass es weitergeht, nahe bleiben will: „Das Wasser kam in der Fischergasse bis zum Fensterbrett. Im Keller hatten wir es oft. Die Wände sogen die Nässe auf wie ein Schwamm. Nichts half. Im Sommer heizen, lüften, Teebaumöl oder Chemie, die Schimmelflecken blieben mir und der Geruch nach feuchtem Verputz. Er kroch in die Kleider, in die Bettwäsche und ins Haar, auch Sandelholz und Patschuli kamen dagegen nicht an. Ich konnte mich nicht mehr riechen. Der Geruch der Armut hat Nuancen. Kalter Rauch kann dabei sein, ein schlechter Zahn, ungelüftete Räume, Kleiderschweiß, Haarfett, aber Basisnote bleibt für mich der Geruch nach feuchter Mauer.“
Die Kunst, eine gute Erzählung oder Kurzgeschichte zu verfassen, besteht ja darin, aus einfachen, alltäglichen Situationen und Charakteren Spannung und Tiefe zu ziehen. In diesem Sinne ist Kain mit Hohe Wasser ein außergewöhnlich gutes Buch gelungen.