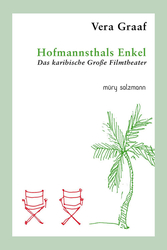Denn auch über Hofmannsthals Tochter Christiane, verheiratete Zimmer, gäbe es eine staunenswerte Fülle zu erzählen. Nach ihrer Flucht erst nach Großbritannien, dann 1940 weiter in die USA unterhielt sie dort ein offenes Haus – dabei war das Wohngebäude in Greenwich Village auffallend schmal – und zahlreiche Intellektuelle, Denkerinnen und Autoren verkehrten bei ihr und waren mit ihr, die im Jänner 1987 hochbetagt verstarb, bekannt und befreundet, von Hannah Arendt über Max Frisch bis zu Peter Handke.
Und eine ebenso krauslebendige Fortschreibung der Hofmannsthalschen Kreativität fand sich bei ihrem einzigen Sohn Michael (1934-2008). Früh Halbwaise – sein Vater Heinrich Zimmer, ein renommierter Indologe, starb 1943 –, latent in einer amourösen Überkreuz-Viererbeziehung aufgewachsen – darüber schrieb die Schweizer Autorin Katharina Geiser 2015 ihren Roman „Vierfleck oder Das Glück“, erschienen im Salzburger Jung und Jung Verlag –, an der Harvard University ausgebildeter Architekt, dann mit 30 Jahren Aussteiger, der in die Karibik zog, sich als Hippie durchbrachte. Sein bürgerlichen Zwängen enthobenes Leben konnte er finanzieren, weil er an der Ausschüttung der Hofmannsthalschen Autorentantiemen und Aufführungsrechte partizipierte.
Er war ein leidenschaftlicher Filmenthusiast, der seine Kleidung perfektionistisch an den jeweiligen Film anpasste. Gab es einen italienischen Streifen, trug er einen eleganten Kaschmirpullover, bei Werken aus Skandinavien entschied er sich für grobgestrickte Fischerpullover. 1968 lernte er Vera Graaf, eine 28-jährige Berlinerin, in New York kennen, sie verliebten sich ineinander und wurden ein Paar.
1969 erwarb er ein kleines Grundstück auf der Antilleninsel St. Barthélémy. Auf dem benachbarten Eiland Virgin Gorda, das zu den British Virgin Islands gehört, abgelegen ist und daher außer sehr einfachen Lebensbedingungen kaum etwas bot, eröffneten sie 1974 ein Lichtspieltheater. Davon erzählt Graaf in „Hofmannsthals Enkel“, von ihrem Projekt eines karibischen Großen Filmtheaters. Der Untertitel ist natürlich eine direkte Anspielung auf die sich heuer zum 100. Mal jährende Premiere der Salzburger Festspiele, deren Herzstück bis heute die Freiluftinszenierung des „Jedermann“ auf dem Domplatz ist, Hofmannsthals Festivitäts-Konzeption eines Großen Welttheaters.
Ihrer beider Enthusiasmus war so groß wie ihre unternehmerische Naivität. Eine Prise Glück kam dazu. Das Gespräch mit dem Kinoverleih-Mogul der Karibik nahm eine völlig unerwartete Wendung. Nachdem er hörte, dass sein Gegenüber der Enkel Hugo von Hofmannsthals sei, brachen beim bis dahin sarkastisch warnenden Mahner Erinnerungen an die eigene Kindheit durch. Dieser Mann namens Al Morse war in Wien aufgewachsen, seine erste Oper „Der Rosenkavalier“. Auf der Stelle bot er Hilfe an.
Rasch aber zerschlug sich die Idee eines Freiluftkinos unter lindem Sternenhimmel. Zu windig. Zu viele Moskitos. Viel zu viele Genehmigungen. Dann wurde ihnen ein Saal offeriert ausgerechnet in einem der in Graafs Augen hässlichsten Neubauten der Insel, im Shopping Center nahe des Hafens. Gebaut aus falschen Natursteinen. Die Mauern in einem geschmacklos-revoltierenden Senfgelb gestrichen. Das Walmdach gedeckt mit Plastikschindeln. Doch sie verwandelten den großen Saal in Ansprechendes, mit Herzblut und durch Selbstausbeutung.
Sie lernten mit der Zeit, welche Filme in ihrem Kino, „Argus“ betitelt, gut gingen (absoluter Hit „The Sound of Music“), welche Scham auslösten, welche Abscheu („Der Pate“, zu brutal), und welche langweilten. Interkulturelle Unterschiede traten während der Filmvorführung zutage – es war keineswegs still, vielmehr wurde lauthals das Geschehen auf der Leinwand kommentiert, viele standen auf und holten sich am Erfrischungsstand etwas zu trinken und zu essen. „In vielerlei Hinsicht“, so Graaf, ähnelte „das Argus dem elisabethanischen Theater, wo die Schauspieler mit Kohlköpfen und Hühnerknochen beworfen wurden und überhaupt das Publikum sich während der Vorstellung keinerlei Zwang antat.“ Nun, erinnert man sich beispielsweise des autobiografischen Kino-Kindheitsfilms „Nuovo Cinema Paradiso“ (deutscher Titel: „Cinema Paradiso“) des Sizilianers Giuseppe Tornatore aus dem Jahr 1988, so gänzlich anders war es zumindest im Südeuropa der 1940er und 1950er Jahre im Kinosaal nicht.
Mit der Zeit nahm Graaf die Teilung in diesem Schein-Idyll wahr: hier die dunkelhäutigen „Gordians“ in einfachen Häusern und Hüttchen, dort die Weißen, die „Honkies“, die klimatisierte Bungalows am Yachthafen bewohnten oder Villen an den Berghängen. Das Leben der Einheimischen war hart, bitter und simpel, ihr eigenes angemietetes Häuschen mehr als asketisch, zuvor lang nicht mehr bewohnt (von einem Geist geplagt) und fast baufällig. Sie stellt sich nachdenklich die Frage: „Wer sind wir, Michael und ich, eigentlich in dieser kleinen Welt?“ So ist dies auch eine Meditation über Fremde, Ankommen und über Akkulturation durch Kultur. Die scheitert. Ihre Flucht vor dem Konkurs nach elf Monaten inszenierten sie als Nacht-und-Nebel-Aktion – spur- wie nachrichtenlos verschwanden sie.
Nur stichwortartig streift Graaf im Nachwort dann die späteren Jahre nach dieser cinephilen Lebensepisode. Rückkehr nach New York. Der Bruch der Beziehung 1984. Ihre journalistische Tätigkeit als Korrespondentin für deutsche Zeitungen. 1990 Zimmers zweite Ehe. 1996 die Gründung seines „Sardine Museum & Herring Hall of Fame“ wieder auf einer Insel, auf Grand Manan in New Brunswick, Kanada. Im Oktober 2008 starb Michael Zimmer. 2003 hatte Graaf einen kurzen Dokumentarfilm über das Sardinenmuseum realisiert.
Dieses einfühlsame Memoir über das gemeinsame Abenteuer-Projekt eines karibischen Großen Freilicht-Film-Welttheaters ergänzt das exzentrische Werk dieses Lebenskünstlers, der stets zwischen Familienhistorie, Verpflichtung und ganz eigenem Aufbruch navigierte. Ihre Charakterisierung von Zimmer nach einer dauerhaften Besucherflaute ihres Kinos mutet stimmig an: Leben müsse Drama sein, alles müsse Spektakel werden. In dieser Beziehung, resümiert Vera Graaf, war „er ganz der Enkel seines Großvaters: ein launenhafer, schwieriger Kreativer, ein echter Hofmannsthal.“