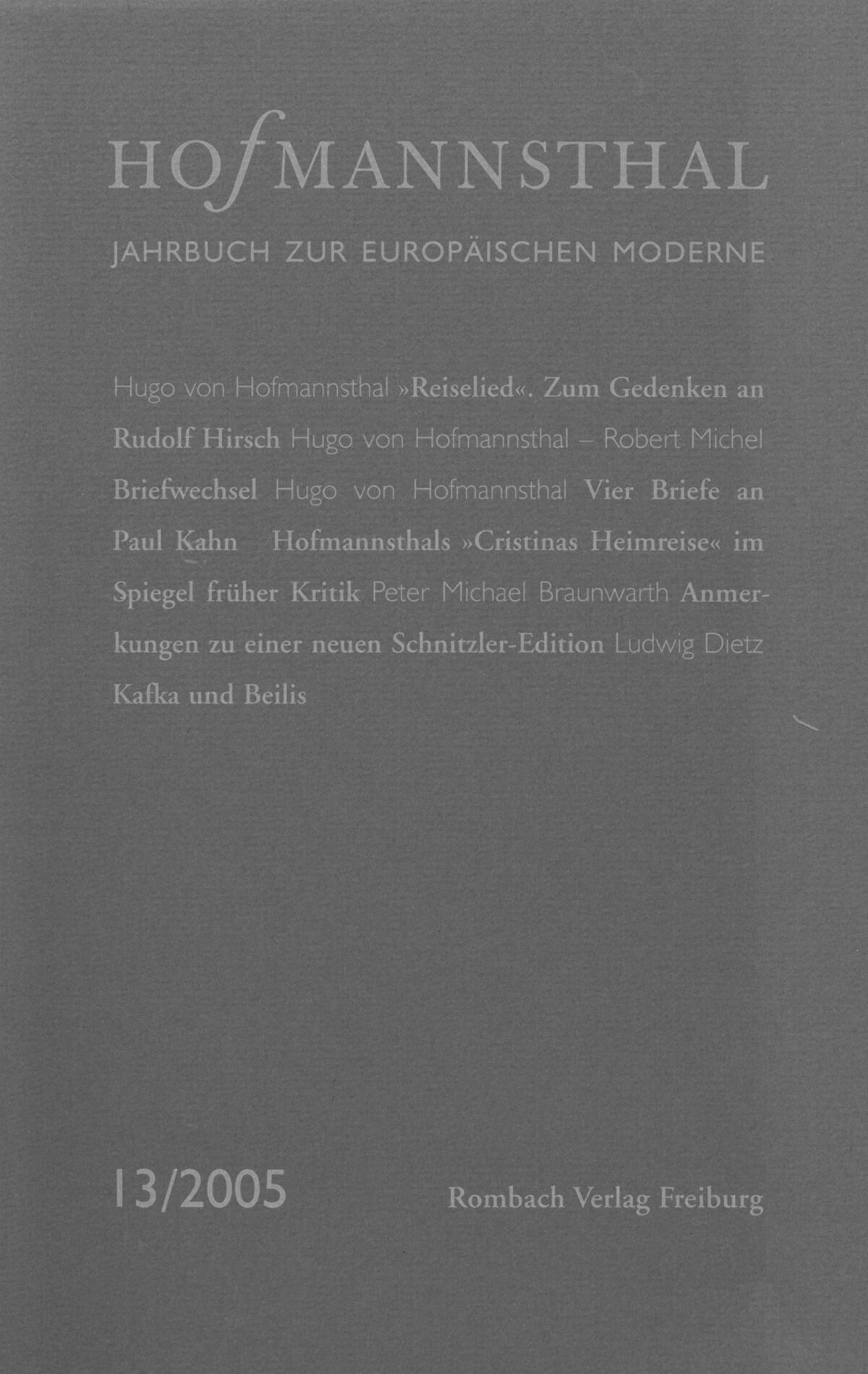Schnitzler mit einer peniblen Auflistung der Entzifferungsfehler, die in der Edition der Urfassung des „Reigen“ unter dem Titel „Ein Liebesreigen“ (hg. von Gabriella Rovagnati, Frankfurt/M.: S. Fischer, 2004) zu finden sind, zusammengestellt von Peter M. Braunwarth. Sie lässt es dringlich erscheinen, dass mit kritischen Editionen der Werke Arthur Schnitzlers begonnen wird, wofür es bisher noch nicht die geringsten Anzeichen gibt. Das ist um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die kritischen Bemühungen um das Werk Hofmannsthals schon im fünften Jahrzehnt stehen.
Kafka wird in einer Studie von Ludwig Dietz: „Kafka und Beilis“ behandelt. Der Autor gewinnt den Impuls zu seiner Arbeit aus dem Unbehagen, dass ein von ihm vor fünfzehn Jahren erfolgter Hinweis von der Forschung nicht aufgegriffen worden ist. Demzufolge hatte Kafka in den zwanziger Jahren vor, ein Buch im Verlag Die Schmiede über den Odessaer Ritualmordprozess von 1911 gegen Menachem Mendel Beilis, der 1913 mit dessen Freispruch endete, zu schreiben. Die offenbar ergebnisreiche Arbeitsphase zu Beginn der 20er Jahre und der Traum, sich in Berlin als Schriftsteller zu etablieren, wurden durch seine Krankheit unterbrochen, die es ihm verwehrte, das „eigentlich Süße aus Berlin zu saugen“. Er konnte das Vorhaben nicht verwirklichen, den Verlagsvertrag nicht erfüllen. Dora Diamant ist – im Unterschied zu Max Brod – Kafkas Aufforderung nachgekommen und hat „an die 20 dicke Hefte“ verbrannt, darunter auch die den Beilis-Plan betreffenden Entwürfe. Neben diesen Korrekturunternehmungen steht im Hauptteil des Jahrbuchs die Edition des Briefwechsels Hofmannsthals mit Robert Michel (150 Seiten), die Kurzfassung einer Wiener Dissertation, die Riccardo Concetti 2003 vorgelegt hat. 85 Briefe Hofmannsthals und sechs Briefe seiner Frau haben sich erhalten und werden durch ein unvollständiges Konvolut von 41 Gegenbriefen Michels ergänzt. Der Nachlass Hofmannsthals ist so reichhaltig, dass sich immer weitere Briefwechsel ans Licht befördern lassen. Der mit dem um zwei Jahre jüngeren Robert Michel (1876 – 1957) war zunächst von der gönnerhaften Attitüde geprägt, die der erfolgreiche Autor dem mehr bemühten als begabten Offizier entgegenbrachte, der ihm – auf Vermittlung Leopolds von Andrian – seine ersten Arbeiten zur Begutachtung vorgelegt hatte. Michel, der im Laufe seines langen Lebens ein umfangreiches Werk zustande brachte, fand sein eigentliches Thema in der Beschreibung des Südostens der Österreich-Ungarischen Monarchie. Im 1908 von Österreich annektierten Bosnien-Herzegowina stationiert, sammelte er Sagen, Geschichten, erzählte von den Bewohnern und Basaren und wurde so zum einzig wichtigen Chronisten dieser Region. Hofmannsthal konnte seine Beobachtungen und Sammlungen brauchen, als er während des Ersten Weltkriegs im Insel-Verlag die „Österreichische Bibliothek“ herausgab.
Michel steuerte als Band 11 „Auf der Südostbastion unseres Reiches“ (1915) bei, in dem es zum Beispiel heißt: „in unseren Reichslanden gerät die Kultur des Orients mit der des Okzidents in Wettkampf. Es ist kein Zweifel darüber, wie dieser Kampf enden muss. Jedoch der Sieg der europäischen Kultur würde nur dann ehrenvoll sein, wenn es gelänge, alles Wertvolle aus der orientalischen Vergangenheit dieser Länder zu erhalten; aber nicht nur es als ein totes Schaustück zu erhalten, sondern es als Lebendiges einzufügen in das, was durch die neue Entwicklung entsteht.“ Hier wird das staatspolitische Interesse deutlich, Dominanz mit Toleranz zu verbrämen. Die tatsächliche Kolonisierung wurde durch bemühte Konservierung der einheimischen Tradition beschönigt.
Hofmannsthal, der sich nicht scheute, nicht nur offiziell, sondern auch im privaten Brief (an Michel, am 24.1.1915) von „diesem glorreichen Krieg“ zu sprechen, verlangte von Michel, er möge „Daten über besonders schönes Verhalten unserer Moslim, nicht nur als Soldaten sondern auch sonst als loyale Untertanen“ beibringen. Dem hat dieser dann aber doch nicht entsprochen.
Der Briefwechsel enthält auch Kurioses, wie die einträglichen Machenschaften, im okkupierten Polen Antiquitäten günstig zu erwerben. Ulrich Weinzierl hat in seinem „Hofmannsthal“ (Wien: Zsolnay, 2005) vermerkt: „Politische Korrektheit würde derlei wohl als Kriegsgewinnlertum brandmarken.“ (S.65).
Der Briefwechsel enthält aber auch dramaturgische Einsichten, wie sie in dieser Deutlichkeit bei Hofmannsthal selten sind: „Die Bühne räumt manche Elemente eines poetisch Erfundenen erbarmungslos bei Seite. Hier [in Michels Lustspiel „Der weiße und der schwarze Beg“] ruht fast alles auf dem Zauber des Volkstümlichen, auf einer absoluten Naivetät, die durch ihre Echtheit bezaubern. Das Echte fällt auf der Bühne weg, in den Costümen dieser naiven Wesen stecken Comödianten und Comödiantinnen; das Dünne der Erfindung (woran aber nicht zu rühren ist, ohne dass man das Ganze prostituiert) wird noch dünner, das Naive wird vielleicht albern, ja stellenweis wird es roh wirken.“ (S.108f.). Hier wird Michels bescheidenes Talent wohlwollend akzeptiert, zugleich aber die Brutalität der theatralischen Umsetzung ins Spiel gebracht. Dem Lustspiel war kein Erfolg beschieden.
Michel, der Hofmannsthal um fast dreißig Jahre überlebte, hat dem großen Kollegen, mit dem er sich befreundet fühlen durfte, ein liebevolles Andenken bewahrt: „Jede Beklemmung ist sofort gewichen, als ich in Hofmannsthals Augen blickte, die, gütig und beredt, weit rascher eine Verständigung ermöglichen, als es Worte vermögen.“ (S. 17).
Ein zweiter großer Teil des Hofmannsthal-Jahrbuchs ist der Rezeptionsgeschichte von Hofmannsthals gescheitertem Lustspiel „Cristinas Heimreise“ gewidmet (115 Seiten); eine vollständige Dokumentation der zeitgenössischen Kritik, gesammelt von Mathias Mayer, der eine ähnliche Zusammenstellung über das „Andreas“-Fragment im Hofmannsthal-Jahrbuch von 1999 herausgebracht hat. Das Bemerkenswerte an der zeitgenössischen Aufnahme des Stücks ist die Sensibilität und Aufmerksamkeit der Rezensenten, die dem Vorurteil, dass erst nach angemessenem historischen Abstand eine objektive Beurteilung möglich sei, überzeugend widersprechen.
„Cristinas Heimreise“ hätte in der Zusammenarbeit mit Richard Strauss die moderne Version des „Don Giovanni“ werden können, so wie „Die Frau ohne Schatten“ als Spiegelung der „Zauberflöte“ gilt. Faszinierend zu beobachten, wie Hofmannsthal um den Casanova-Stoff ringt, um nicht der Versuchung, daraus ein Libretto zu machen, zu erliegen.