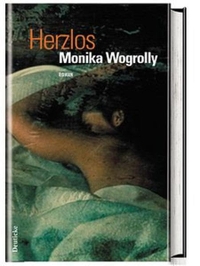Im Anhang findet sich dann – komplementär dazu – eine ausführliche Danksagung, in der vermutlich alle jene „existierenden Menschen“ angeführt werden, die dem Roman einen Teil ihrer Charakterzüge beigesteuert haben, wenngleich verzerrt bzw. verschmolzen mit anderen, kurzum entautobiographisiert und fiktionalisiert.
Wenn Selbstverständliches geradezu emphatisch (und nicht in ironischer Absicht) ausgeführt wird, macht es mitunter misstrauisch und erweckt den Anschein der Naivität. Und damit geschähe dem Roman tatsächlich Unrecht, denn Naivität oder Ironielosigkeit kann man ihm nicht vorwerfen.
Sarah, die Ich-Erzählerin und Protagonistin, ist vielmehr mit allen möglichen Wassern gewaschen. Die ausgebildete Psychologin und ausübende Radiomoderatorin hat soeben eine Nacht mit einem Perser im Hotel Orient verbracht. Am Morgen darauf meldet sie sich bei der Polizei und legt ein Mordgeständnis ihren Vater betreffend ab. Ihr betagter Vater, den sie seit dem 17. Lebensjahr nicht mehr gesehen hatte, ist plötzlich spurlos verschwunden. Der Schriftsteller und Geologe, Empfänger des Staatspreises für Literatur, hat die letzte Zeit vor seinem Verschwinden in einem Geriatrischen Krankenhaus zugebracht. Das Mordgeständnis, das sie im Verlauf des Romans noch öfters erneuern wird, nimmt man der Tochter nicht ab. Stattdessen attestiert ihr der Polizeipsychologe Folgeerscheinungen einer Wochenbettpsychose. Ihr Mann Erdal ist mit ihrem Säugling Johanna nach Istanbul abgereist, wo er in einem psychiatrischen Krankenhaus arbeitet. Sarah wird nicht nachkommen, wie es vereinbart war, der Zwischenfall mit dem Vater kommt ihr gelegen.
Doch während sie noch Luft holt, stockt ihr schon der Atem: „Ich kann nicht vor und nicht zurück. Hier ist Vater. Dort ist Johanna.“ Der Säugling ist zwar abgestillt, die Sehnsucht nach ihm nicht. Desgleichen bringt das Auftauchen des Vaters in Sarahs Erinnerungen – durch sein Verschwinden – etwas ins Rollen. Bereits das Mordgeständnis ist erkennbar als verschleierter radikaler Versuch, an den unerreichbaren Vater heranzukommen, unter dessen Abweisungen sie als Kind gelitten hatte.
Dazwischen schiebt sich eine Affäre mit dem Polizeipsychologen Tom, die sich unwillkürlich zu einer Beziehung ausdehnt. Tom, dessen Frau soeben gestorben ist und der gegenüber er ein schlechtes Gewissen zu verbergen hat, stellt dabei die Greifbarkeit einer Möglichkeit dar. „Es ist so gut wie Liebe.“ So gut wie gehabt, wie Sarah gesteht: „Ich konsumierte zwanghaft Männer […].“ Auf diese Weise versucht sie, sich von einer ungestillten Sucht nach Glück zu befreien, verfängt sich dabei allerdings stets erneut darin. Am deutlichsten gewinnt sie Einsicht in diesen fortwährend sich (re)konstituierenden Kreislauf, wenn es um ihre sexuellen Erlebnisse und Beobachtungen geht. Diese hält sie in trocken distanzierten Bildern fest, die durch ihre Schroffheit und Nüchternheit überzeugen. Immer wieder wird die blitzartige Gewissheit, dass es Liebe nicht ist, von anderen Gefühlen überlagert und führt schließlich zu einer inneren Verwirrung. Schlagartig weicht das „Glücksgefühl dem Entsetzen“: „Ich war darüber entsetzt, wie vollkommen mir die Täuschung gelang.“ Gerade dass sie durch diese Täuschungsmanöver zugleich die Macht über ihre Männer erhält, ist verführerisch. Doch sie spürt ihre Zweischneidigkeit als Verrat an sich selbst. „Die Männer bisher waren Vorsichtsmaßnahmen gewesen, um nicht genau hinzusehen, mich zu blenden, abzulenken.“ Denn „so lange ich in dem Kreislauf aus Ficken und Küssen blieb, war ich vor mir sicher.“
Die Flucht vor sich selbst, die sie „vor Vater schützen“ sollte, erlebt sie als Anzeichen einer Schizophrenie. Den kategorisierenden Diagnosen (von Persönlichkeitsstörung bis hysterischer Epilepsie usf.) und psychiatrischen Methoden, mit denen der Polizeipsychologe Tom prompt zur Hand ist, begegnet sie teils mit gelassener Ironie. Erschaudern lässt es sie, als dieser ihr eine Elektro-Schock-Behandlung vermittelt. „In Amerika gehen die Frauen zum E-Schock wie zum Friseur , sagte er.“ Tom hätte sie retten sollen. „Doch er wollte mich formen und missbrauchen.“
Stattdessen wird Sarah durch ihre persönlichen Ermittlungen in Vaters Angelegenheit in einen Prozess der Erinnerungen geradezu gestoßen. „Vater ist das unsinnigste Wort, das ich kenne.“ So hat es anfangs noch gelautet: „Das Wort kehrt mir den Rücken, es bedeutet nichts. Es trägt Krawatten. Schon wenn einer Krawatte trägt, laufe ich Gefahr, ihm zu erliegen.“ Doch inzwischen hat eine Spurensuche um ihren Vater begonnen. In seiner Wohnung, die sie nun öfter aufsucht, erinnert sie sich an die „Geruchsbäder“, die sie als Kind und Jugendliche verstohlen in seinem Bett genommen hatte. Dem stehen härtere Erinnerungen gegenüber, seine Abweisungen, seine Verschlossenheit: „Vater hat mich um sich betrogen.“ Eine klassische Doppelgestalt kommt zum Vorschein – ein sympathischer Mensch in Gesellschaft, ein Tyrann zu Hause – aber doch auch eine rätselhafte: „Er war unter uns, doch unerreichbar.“
Auf ihren Wohnungsbesuchen stellt sie eines Tages Veränderungen fest. Vielleicht lebt Vater noch und hinterlässt ihr kleine Botschaften? Sie liest in seinen Büchern. In dem slowenischen Domizil des Schriftstellers, dem „Gehäuse seines Denkens“ findet sie jene Gesteinsarten, nach denen einer seiner Romane benannt ist: „Die Geode“. Geoden sind mit Kristallen ausgekleidete Hohlräume in Vulkangestein. Genauso nimmt sich auch Vaters Schreibdomizil aus: Außen hässlich, innen taten sich Welten auf. Jenseits dieser tastenden Neugier eskalieren jedoch auch Gewaltfantasien: „Ich wollte Vaters Tür aufbrechen, auf ihn einstechen mit scharfen Messern, ihn von allen Seiten durchbohren […]. Ich wollte ihn aufbrechen und spalten wie eine Geode, um ihn zu öffnen und in sein Inneres zu sehen.“
Schließlich erhält die Tochter jenes „ominöse Manuskript“ des Vaters, das ursprünglich den Verdacht auf sie gelenkt hatte, ein tagebuchartiges Schriftstück, das ausgerechnet den Titel „Sarah“ trägt. Hat der Verfasser seine Tochter doch geliebt? Neben deutlichen Hinweisen darauf mischt sich Skepsis: „Vater hatte mich ausgeheckt. Er war mein Schöpfer. (…) Er schrieb mein Leben.“ Die Subtilität dieser Aussage wird ihre ambivalente Gültigkeit bewahren. Auch dann, wenn ihr Vater – in bewusstlosem Zustand – doch noch aufgefunden wird. Zugleich aber ist bereits „Liebe durch die versperrte Tür hindurchgesickert“. Mit dem im Wachkoma Liegenden gelingt, verspätet zwar, ein zärtlicher Dialog. Husten und Schleimproduktion sind als „Vaters neue Sprache“ erkennbar, das Röcheln des Komatösen als letzte Liebeszeichen des „herzlose[n] Scheusal[s]“, der „Geode, deren Glitzern niemand sah“.
Auf Vaters Beerdigung zieht Sarah das Taschentuch hervor, das ihre Initialen trägt und das sie zu Beginn des Romans im Regen gefunden hatte: SM kann für den sadomasochistischen Kreislauf stehen, aus dem sie nun heraustritt, umgekehrt für die neue Identität, die sie hiermit wiedergewinnt. Ein Neubeginn mit Erdal und Johanna, die zurückgekehrt sind, scheint jetzt möglich. Trotz dieser versöhnlichen Aussichten sind dem/der LeserIn inzwischen Assoziationen mit womöglich seichten Heftchenromanen gründlich aus dem Sinn gekommen.