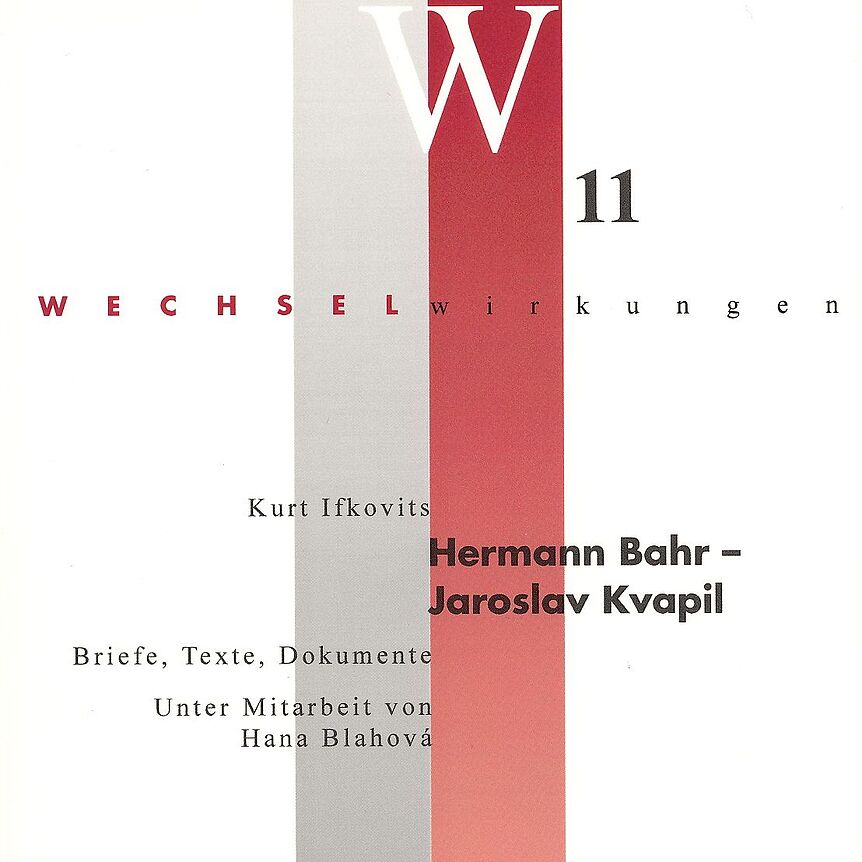Gut 230 Briefe haben Hermann Bahr und Jaroslav Kvapil ausgetauscht, der ‚Herr von Übermorgen‘, zugleich als Vermittler und Programmtexter der „Moderne“ geschätzte Autorität für die sich ab 1894/95 formierende jungtschechische Literatur-Bewegung, der „sympatický spisovatel“ (S. 30) aus Wien, und der Organisator der tschechischen Moderne, der „böhmische Reinhardt“ (S. 473) und spätere Verfasser des „Manifests der tschechischen Schriftsteller“, das kulturpolitisch schon vor dem Ende des Habsburgerreiches im Mai 1917 den Bruch zu Wien vollzog.
Den Ausgangspunkt dieser Beziehung, die zunächst nicht recht in Gang kommen wollte, bildete die von Bahr mit herausgegebene Wochenschrift „Die Zeit“, in der junge tschechische Kritiker und Schriftsteller wie F. V. Krejčí, J. S. Machar und F. X. Šalda schon 1894 über Aspekte der slawischen Moderne schrieben, Autoren im deutschen Sprachraum vorstellten und umgekehrt dafür sorgten, dass Bahr zu einer zentralen Bezugsinstanz ihrer Generation werden konnte. Auf Interesse dürfte dabei die von Bahr lancierte ‚moderne‘ Idee einer Synthese aus den in Paris aufgegriffenen états d’ámes und dem in Berlin eingesogenen Naturalismus sowie Ibsen gestoßen sein. Auch das zwar nebulose, aber vor dem Hintergrund des erstarkenden Deutschnationalismus verständig anmutende Konzept einer österreichischen Kultur als „biegsame[r] Versöhnung der fremdesten Kräfte“, worunter nichts anderes als eine Kultursymbiose aus „romanischen, deutschen, slavischen Zeichen“ angedacht war (Studien zur Kritik der Moderne, 1894), bot mit seiner prinzipiellen Dialogbereitschaft einen brauchbaren Ansatz. Vor diesem Hintergrund ergriff Kvapil 1896 die Initiative und trat an Bahr heran; allein die Begegnung kam nicht gleich, sondern erst zehn Jahre [!] später zustande. Anhalten sollte sie dann aber, meist als Briefbeziehung begleitet von fast jährlichen Treffen, bis in die letzten Lebensjahre Bahrs, d. h. bis etwa 1932, nach 1917 freilich sporadischer, wenngleich stets wechselseitigen Respekt bekundend; das letzte Treffen der beiden datiert denn auch in das Jahr 1922. Doch zwischen 1908 und 1916 schrieben sie sich fleißig, und phasenweise hat es den Anschein, als könnte aus diesem wechselseitigen Austausch, dem das Bemühen um Annäherung und Wertschätzung der jeweils anderen Kultur, um eine Begegnung auf gleicher Augenhöhe, nicht abgesprochen werden kann, etwas Größeres, Zukunftsweisendes werden. Freilich stand dahinter um 1908/10 auch eine Art Zweckgemeinschaft, eine unausgesprochene Interdependenz mit symbolischen und konkreten Kapitalflüssen auf den literarisch-kulturellen Feldern von Wien nach Prag und retour: Bahr unterstützte Kvapil, dessen Regietechnik an Reinhardt und Stanislawski orientiert war, bei seinen Anstrengungen, am tschechischen Nationaltheater (Národního Divalda) ein anspruchsvolles Programm aus klassischer und internationaler Moderne neben jungen tschechischen Autoren durchzusetzen. Ferner lieferte Bahr publizistische Beiträge, welche gegen die aufgeheizte antitschechische Stimmung und für den kulturellen Aufbruch der Tschechen Position bezogen; er fuhr 1908 demonstrativ nach Prag, um sich heftige Anfeindungen in der deutschsprachigen Presse einzuhandeln, und dies zugleich für seine großösterreichische Idee einer neuen, austro-slawischen Kultur zu verwerten, in dem Sinn, „dass in Österreich die neue deutsche Kultur nur noch bei den Slawen zu finden sein wird.“ (Dalmatinische Reise, 1909). Es mutet wie ein Treppenwitz der Literaturgeschichte an, aber Bahr selbst sprach und verstand kein Tschechisch, konnte daher der innertschechischen Diskussion, die ihm von Kvapil filtriert vermittelt wurde, nicht folgen. Umso eifriger skizzierte Bahr löbliche Projekte der Aussöhnung, doch eben unter eher eigenwilligen kulturpolitischen Perspektiven, die letztlich an der Realität vorbeigingen. Kvapil, ohnedies ein ‚Gemäßigter‘ und daher mehrmals im Visier nationalistischer Agitation sowie fein gesponnener Intrigen, dachte allerdings weniger an eine Integration der tschechischen Literatur in jene großösterreichische Kulturidee; er verstand den Aufbruch, je sichtbarer er sich abzeichnete, zunehmend als das, was er war, als Leistung der tschechischen Moderne. Was ihn nicht hinderte, sich zugleich als Regisseur zu sehen, der 1914 sogar einen – von Bahr als unmöglich eingeschätzten – Wechsel an eine größere deutsche Bühne in Erwägung zog (S. 155), zumal er als exzellenter Shakespeare- und Ibsen-Kenner galt. Bahr lieferte v. a. zu Beginn Anregungen, war sein wichtigster Mittelsmann zur deutschsprachigen Theaterszene, ja zeitweilig wohl ein Freund, – zumindest Kvapil empfand die Beziehung als Lebensfreundschaft (S. 195), jedenfalls können wir sie als intellektuelle Weggefährten ansehen. Dankbar übersetzte Kvapil einige Stücke wie z. B. Sanna und Die Kinder (wofür er die österreichische Uraufführung erhielt), oder fädelte solche ein wie im Fall von Das Konzert oder Das Prinzip und brachte sie in Prag (mit wechselnder Resonanz, ja selbst unter Inkaufnahme von Kritik, z. B. durch Šalda) zur Aufführung.
Das sicherte Bahr im tschechischen Raum eine beachtliche Bühnenpräsenz, während Kvapil durch ihn im deutschsprachigen zu Kontakten und Anerkennung kam und Bahr auf neuere Entwicklungen in der slawischen Welt insgesamt aufmerksam machte. Eine erste Abkühlung in dieser Beziehung, die von Bahrs Seite, so der Eindruck aus den Briefen, mitunter ein wenig im Zeichen seines notorischen Förderergestus stand, machte sich 1913/14 bemerkbar: Die Briefe werden nach der freilich sehr kurzfristig angebotenen Uraufführung von Das Prinzip, auf die Kvapil zu spät reagierte, knapper, formelhafter; erst im Vorfeld des Kriegsausbruches nehmen sie wieder an Intensität zu, als sich Bahr vorbehaltlos und zur Verwunderung des späteren Pazifisten Stefan Zweig bei höchsten Stellen wie den Ministerpräsidenten Stürgkh und Tisza (S. 361) für eine Freilassung des kroato-dalmatinischen Dichters Vojnovich einsetzt, um die Kvapil gebeten hatte – auch als Zeichen der Wertschätzung der slawischen Kultur in ‚großer‘, für die Tschechen zuallererst von Zensur und latenter Inkriminierung geprägten Zeit, die ihren tristen Höhepunkt im Kramář-Prozess finden sollte. Trotz dieser riskanten Vor- und Fürsprache musste sich ein erster Dissens im Zuge der österreichpatriotischen Agitation Bahrs alsbald einstellen: Kvapil konnte auf Bahrs Österreichische Wunder offenbar nicht anders als mit dem Satz „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!“ (S. 172) reagieren; er bot aber allen guten Willen auf, Bahr in seinem Einsatz für eine (deutsch)österreichisch-tschechische Annäherung zu unterstützen, die Kvapil allerdings viel weiter dachte, nämlich, und dies schon Ende 1915, hin zu „Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen und des Volkes“ (S. 185). Von da an scheiden sich die politischen Ansichten und Zukunftsvisionen.
Während Bahr unermüdlich einem „Österreich eines freien Staatenbundes sich selbst bestimmender Völker unter Habsburg!“ das Wort redete und sich dabei sogar Kramář, jedenfalls aber Masaryk als Ministerpräsidenten vorstellen konnte, hat sich Kvapil und mit ihm die tschechische Elite trotz gut gemeinter Bahrscher Feuilletons, trotz flammender brieflicher Appelle (Rettung Österreichs durch das böhmische Volk, so im September 1917!) ab 1915/16 daraus schrittweise verabschiedet. Immerhin, so wendefreudig Bahr sonst auch gewesen ist, in dieser Causa hat er erstaunlich einsichtig den Lauf und den Spruch der Geschichte zur Kenntnis genommen; er hat 1918 und später noch mit Bewunderung im Tagebuch von der kongenialen Allianz zwischen Staat, Nation und Kunst unter Masaryk, dessen Rückkehr aus dem Pariser Exil übrigens Kvapil maßgeblich vorbereitet hat, gesprochen. Und dass Bahr bis Mitte der 1920er Jahre Masaryk als Präsidenten einer Art Donaukonföderation – wohlgemerkt unter tschechischer und nicht österreichischer Führung – vor Augen hatte, zeugt von einer in jener Zeit seltenen Ressentimentlosigkeit, ja von einer Utopieversessenheit Musilschen Anklangs, die Wertschätzung verdient, ebenso die im Dezember 1918 an Kvapil übermittelte Bitte, ihm doch „ein großes neues tschechisches Stück“ für das Burgtheater zu schicken. Entwickelten sich auch die Interessen und Wirkungsräume der Briefpartner nach und nach auseinander, so gelingt es nach einigen Jahren Abstinenz wieder an den literarischen Vermittlungsdiskurs anzuknüpfen, allerdings nur punktuell: Bahr mit einer Würdigung Březinas, die auch im Anhang nachlesbar ist, Kvapil mit einer Prager Aufführung von Bahrs Konzert, um ab 1926/27 doch unübersehbar einer Alterskorrespondenz Platz zu machen, in der die jeweiligen Gebrechlichkeiten und gelegentliche Bitten um Fürsprachen nebst elegischen Anwandlungen den Ton bestimmen.
Sind bereits die von einer ausholenden Werkbiographie einbegleiteten Briefe und deren Edition als Glücksfall zu bezeichnen, so gebührt dem Kommentar, dem Materialien- und Quellenteil uneingeschränktes Lob. Sämtliche in den Briefen genannte Personen, und das sind nicht wenige, sowie Anspielungen auf Ereignisse (Theater, Literatur, Presse, Politik) werden exakt aufgeschlüsselt und belegt einschließlich der Aufführungen und Übersetzungen, die Bahr im tschechischen Raum erlebte; ja in Einzelfällen kommen weitere Nachlassdokumente wie Briefstücke mit Dritten zum Abdruck. Damit erhält das Spektrum und die Qualität der wechselseitigen Beziehung und der Vermittlungsbemühungen eine weitere Tiefendimension. Neben kaum bekannten Namen von ÜbersetzerInnen, Redakteuren oder Theaterleuten kommen auch Hofmannsthal, Pannwitz, Zweig, Beneš, Březina oder Kramář zu Wort. Aufschlussreich und lesenswert präsentiert sich insbesondere der Materialienanhang, der minutiös und in beiden Sprachen die Pressereaktionen und Kontroversen nachzeichnet, welche Bahrs Einsatz für die tschechische Literatur, Kultur und Autonomie nach sich gezogen haben. Wie kleingeistig sich da manches im Rückblick ausmacht, das Bahr bereits als solches denunziert hat, macht geradezu betroffen angesichts der Dialogbereitschaft auf der einen, der tschechischen und der offensichtlich doch überwiegenden Verweigerungshaltung auf der anderen, der deutsch-prager Seite. Kurt Ifkovits und seine Mitarbeiterin Hana Blahová haben mit dieser Briefedition einen geradezu beispielhaften Beitrag nicht nur zur Bahr- sondern auch zur Kulturtransferforschung geleistet und die literarische Kultur-Landkarte zwischen 1910 und den 1920er Jahren um Aspekte bereichert, die bislang gerade nur in Fußnoten angesprochen worden sind.