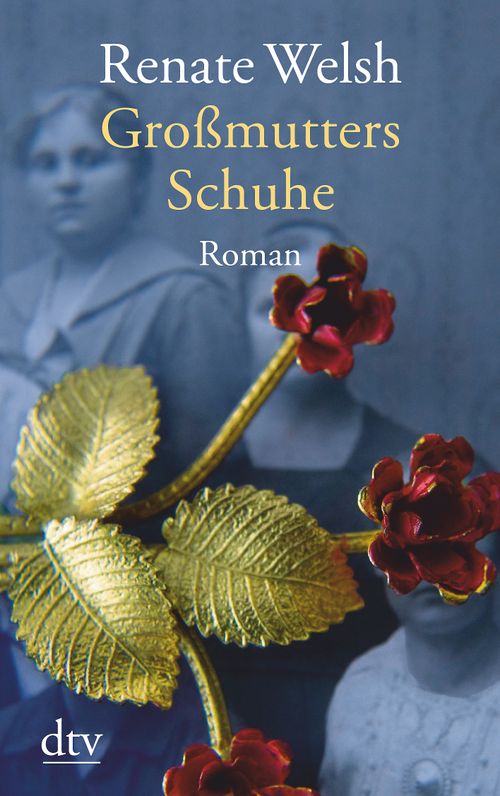Welshs Trauergäste allerdings werden kaum laut, die Auseinandersetzung mit der Verstorbenen erfolgt still, in Form innerer Monologe. 19 Personen dürfen von sich und der Verstorbenen erzählen. Einer nach dem anderen und jede nur einmal.
Durch die unterschiedlichen Perspektiven wird ein vielschichtiges, aber dennoch stimmiges Bild von der Toten und den Menschen um sie herum gezeichnet. Das Lesen wird zum Puzzlebauen; ein Stein fügt sich zum anderen, bis ein Familien- und Zeitporträt entstanden ist.
Eine schillernde Person scheint Edith Karmann gewesen zu sein. Bissig, schlagfertig, gut, gönnerhaft; hat kleingemacht und aufgerichtet. Je näher man ihr war, desto schwieriger hatte man es. „Als Mutter warst du eine Katastrophe“ (S. 145), meint eine ihrer Töchter. Doch trotz aller Verletztheit wird ihr Monolog nicht zur Anklage. Sie verfügt – wie viele andere, denen mehr Platz gegeben wird – über ein hohes Maß an (Selbst)reflexion.
Indem sie von der Verstorbenen erzählen, erzählen alle Beteiligten auch von sich – von sich und ihren Problemen: Was in den besten Familien vorkommt, fehlt auch in dieser nicht: Seitensprünge, Scheidungen, Alkoholismus; von den Kindern enttäuschte Eltern, sich verschließende Söhne und Töchter.
Da VertreterInnen verschiedener Generationen zu Wort kommen, werden indirekt auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen mitreflektiert. Wie schlimm dürfen Kinder sein? Wie stark Frauen? Wer schränkt wen ein? Glückliche Beziehungen sind in dieser „Frauen-Familie“ eher die Ausnahme. „Die Frauen in deiner Familie sind alle so erschreckend stark, hat Roland behauptet. Stark? Ich weiß nicht […] haben sie nicht eher das Mark aus den Knochen ihrer Männer gezuzelt und sich dann mokiert über die Jammerlappen?“ (S. 95)
Interessant ist auch die Geschichte der Hausbediensteten. Wohl darf sie mit ihrem Sohn am Tisch der Herrschaft Platz nehmen, keinesfalls aber denken, sie hätte ein Anrecht darauf. Wirtschafterin und Sohn gehören nur bedingt zur Familie. Distinktion erfolgt mit subtilen Mitteln. Schließlich hat man es mit „feinen“ Leuten zu tun, die wissen, wie man sich abgrenzt. Beste Wiener Bildungsbürger, die, wenn sie ihren Gedanken freien Lauf lassen, über Liedzeilen von Schubert nachsinnen, aus Don Carlos zitieren und Poe auf den Lippen tragen. Problematisch allerdings wird’s, wenn Welsh auch einem Betrunkenen und einer Alzheimerpatientin die Stimme leiht. Das klingt dann doch ein wenig konstruiert: „Jetzt würden sie wieder sagen, ich bin verkalkt, nein, heute sagen sie das ja nicht mehr, heute muss alles einen Namen haben, den keiner versteht, irgendwas mit Menthol sagen die einen und mit Alzen die anderen, was immer das heißen soll. Irgendwo war ein Fluss, der hieß Alz, da haben wir geangelt, Forellen, glaube ich. Eine Alz, zwei Alzen, drei Alzen. Die Alzen balzen auf den Walzen und schnalzen“ (S. 112)
Eingebettet sind die den Roman tragenden inneren Monologe in eine Rahmenhandlung. Diese rückt die Bediensteten des Gasthauses, in dem die Zehrung stattfindet, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Vom altdeutschen Extrazimmer wird nach beinahe jedem Erinnerungsbild zum Personal bzw. in die Küche „geschaltet“. Dort sind eine resolute Köchin, eine Studentin, eine junge Polin und ein weiser Mann vom „Balkan“ zugange. Das Küchenpersonal blickt quasi von außen auf die Trauergemeinde und bildet ein Korrektiv bzw. eine Ergänzung zu deren „Innensicht“.
In dieser Rahmenhandlung nun wird überdeutlich, wo Welsh‘ Sympathien liegen: bei den „Dienstboten“; denen, die es schwer haben im Leben. Bedrückende Lebensumstände scheinen hier besonders lebenskluge und warmherzige Menschen hervorzubringen. Das Personal in der Küche ist in seiner Zuneigung füreinander fast mehr Familie als die biologische an der Totentafel.
Am Ende des Romans stehen eine Testamentseröffnung, ein neuer Todesfall und eine versöhnliche Botschaft: Alles kann gut werden…