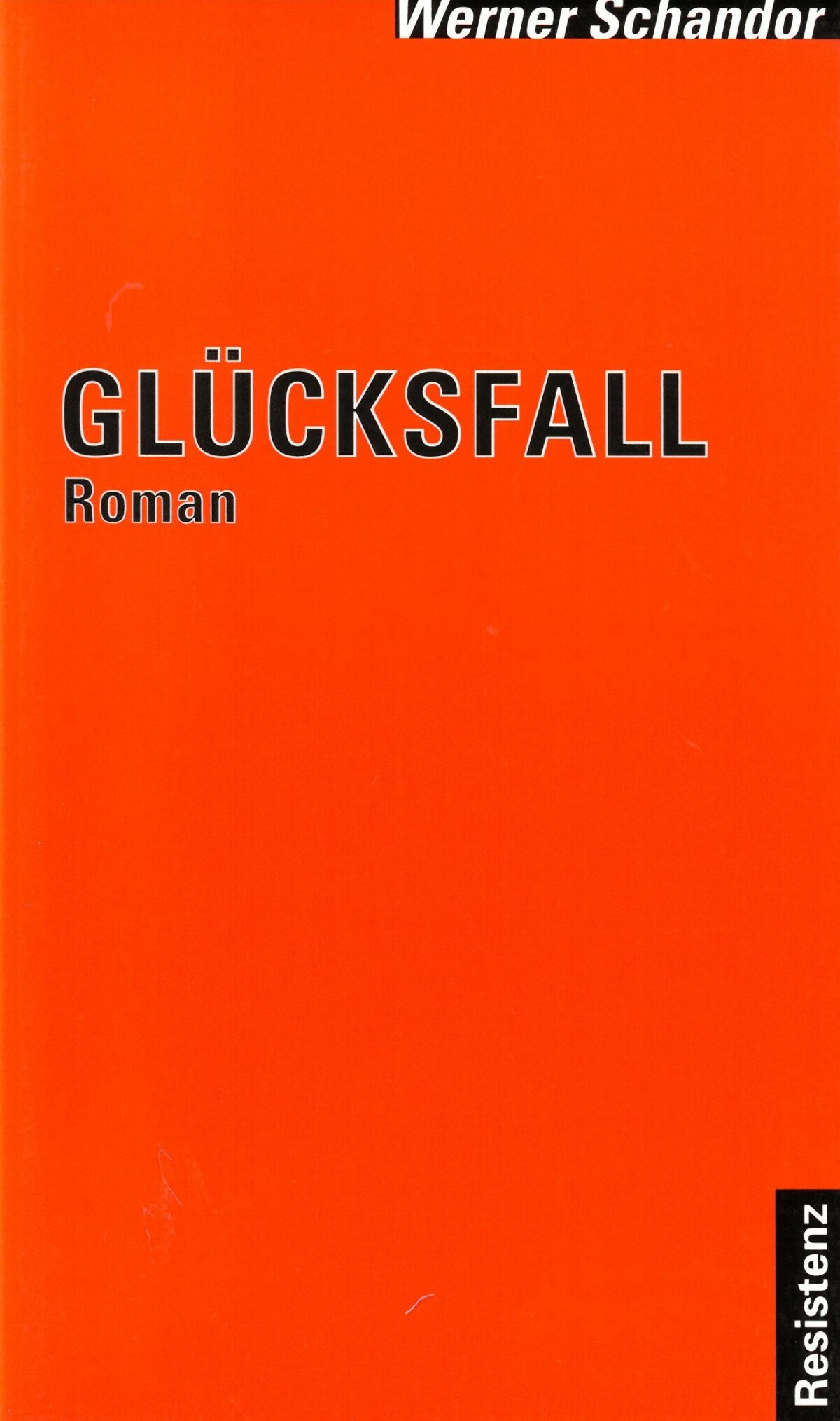Doch was als Kriminalroman beginnt, entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Nicht die Aufklärung von Gewaltverbrechen – dem Dichtermord soll später ein nicht minder grausiger Prostituiertenmord folgen – ist Movens des in sieben Kapitel unterteilten Textes, sondern die Auswirkungen des Mordes auf die Protagonisten des Textes.
In einem ersten Handlungsstrang sind dies Franz Ignaz Gur, leitender Lokalredakteur der „Zeitung anständiger Bürger“, kurz „ZaB“, und Sonja Sudmann, Redaktionsaspirantin und Mitarbeiterin der Kulturseiten der „ZaB“. Sie hat das letzte, von heftigen Kontroversen begleitete Interview mit Pernik geführt, das ausgerechnet am Tag der Ermordung erschienen ist. Bei der „ZaB“ schrillen darauf die Alarmglocken: Um die gute Optik und die ebenso guten Verkaufszahlen zu sichern, wird Sonja kurzerhand in die Lokalredaktion versetzt. Parallel dazu treten Larry, Inglend, Bleck, Ann und Zöhrer auf, alle versandeln „genüsslich ihr Studium, um sich in einem Kosmos aus Musik, Filmen und Drogen breitzumachen“ (S. 15). Doch Ernüchterung setzt ein, als das salopp als „Kiffbros“ bezeichnete Quintett Zeuge des Mordes an Pernik wird und glaubt, einen ihrer Bekannten, nämlich Felix, alias Fix, als Täter erkannt zu haben. Während sich die Antipoden Gur und Sudmann – Gur ein abgebrühter Tastatur-Cowboy, dem Kunst lediglich „blutarme Wichserei“ (S. 74) ist, Sonja ein „Kulturmensch“ (S. 24), der daran glaubt, „dass gute Kunst der Schlüssel zu einer besseren Welt ist“ (S. 53) – in eine heftige Liebesbeziehung verstricken, beschließt die heruntergekommene Studenten-WG, ihren Tatverdächtigen zu beschatten, denn zur Polizei können und wollen sie nicht gehen, weil „‚wenn wir zur Polizei gehen, können wir den Laden ausräumen, das ganze Gras beim Klo runterlassen'“ (S. 16).
Mit pfiffigem (Sprach-)Witz und großem Einfallsreichtum versteht es Schandor, seinen Figuren und der Handlung einen ganz eigenen Drive zu geben. Die legere Unbekümmertheit, die den gesamten Text durchzieht, läßt den Autor scheinbar mühelos mit Sprache, Formen und Gattungen experimentieren: Manchmal durchbricht ein Exkurs den Handlungsverlauf, andernorts lädt Schandor den Leser zur Mitgestaltung ein, indem er in einer erotischen Szene Reizwörter durch Sternchen ersetzt, im 4. Kapitel wird der Roman plötzlich als dramatischer Text weitergeschrieben, und schließlich findet sich auch ein Abschnitt, der zur Gänze im Dialekt verfaßt ist, was für sich genommen noch kein Signal für Originalität ist, würde darauf nicht das hochsprachliche Äquivalent derselben Szene als „Leserservice für nichtösterreichische Leser“ (S. 111) folgen. Man mag „postmoderne Beliebigkeit“ oder „anything goes“ einwenden, der Text verträgt diese moderate Manieriertheit ebenso wie die intertextuellen Einsprengsel, die unverhohlen auf Musil und vor allem auf Kafka anspielen, denn der künstlerische Ziehsohn des ermordeten Dichters, Wahnfried Stompf, der sich bereits als designierter Leiter der nunmehr kopflosen Fadstadter Poetentage sieht, verwandelt sich in eine Ente, womit sich nur schwer leben läßt: „Er fiel wie ein Sack zu Boden und heulte in seine Schwingen. Es war hundsgemein: Warum war er nicht literaturfähig geworden! Warum, zum Teufel, hatte er sich nicht in einen Käfer verwandeln können!“ (S. 144)
Doch hinter all den sprachspielerischen und folglich sprachkritischen Implantaten, hinter den Alkohol- und Drogenräuschen, den Beziehungskisten und megalomanen Provinzliteraten hat sich Schandor auf ein Thema besonders eingeschossen, nämlich auf die Kritik an dem tagtäglich inszenierten Wahnsinn der Medien. Mit spürbarer Genugtuung mokiert er sich über die Unfähigkeit und die Verlogenheit der Zeitungen, die „Zeitung anständiger Bürger“ wird zum Synonym für die durch das Denken in Textmodulen entstandene Geistlosigkeit der Lokalberichterstattung mit ihren „Unfallmeldungen, Gerichtsgeschichten und Alltagsbestiarien“ (S. 7). Somit läßt sich „Glücksfall“ auch als bitterböse Mediensatire lesen, eine von mehreren Lesarten, die dieser spritzige und kurzweilige Text anbietet.