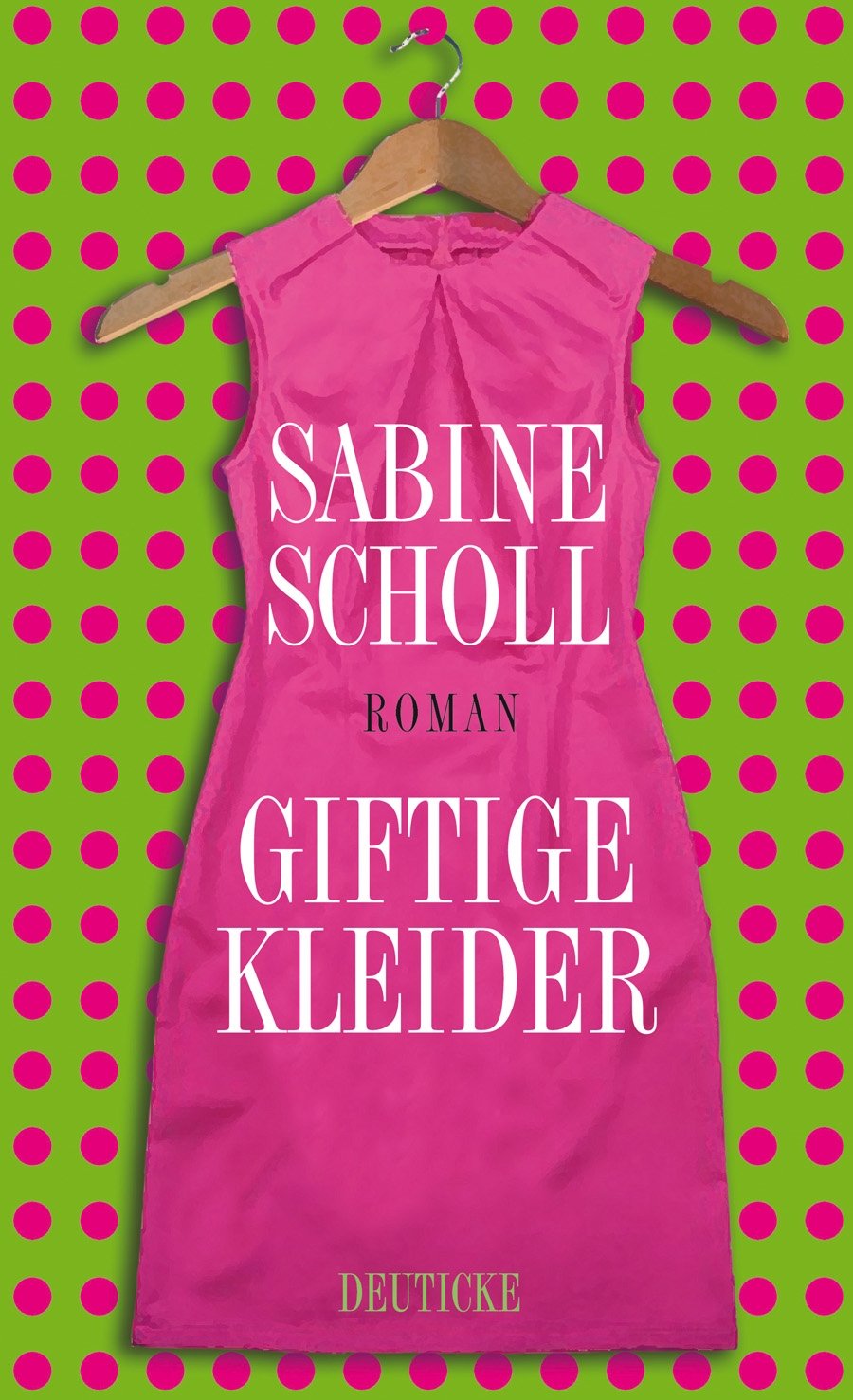Gina ist idealtypische Vertreterin des Prekariats, sie „wusste gar nicht mehr, welchen Beruf sie sich durch welchen finanzierte. Verfertigte sie eigentlich Mode, um als schlecht bezahlte Detektivin zu überleben, oder schrieb sie Kolumnen, um sich die teuren Materialien ihrer Entwürfe leisten zu können? Oder arbeitete sie als Ermittlerin – frei ohne Sozialleistungen und Versicherung –, um durch das unregelmäßige Schreiben von Modekommentaren ihr Ego zu befriedigen?“ Sie soll den Tod von Gerlinde Presenhuber, Mitarbeiterin der österreichischen Botschaft in Berlin, aufklären, deren Dirndlkleid in einem Gasthaus entflammt ist. Dass das Kleid nicht die alleinige Todesursache ist, wird von der Gerichtspathologie nach und nach herausgefunden. Hauptverdächtigter ist der Designer Markus Ball, der in seinen Hashashin-Läden Trachtenjanker aus gefilzter Wolle mit Totenköpfen und Piratentüchern, mit Madonnen bedruckte Damentangas und Dirndlkleider aus dunklen, glänzenden Stoffen mit Blüschen aus schwarzer Spitze vertreibt. Dann gibt es noch den Surflehrer und Kellner Ringo, der sich für Bomben interessiert, die Anwältin des Frauenzentrums „Glanz und Gloria“ Astrid Altmeyer, die eine Freundin der ermordeten Presenhuber war, und den „Geschäftsführer der Initiative Saubere Einkaufstasche“, Lorenzo mit dem Ökowahn, in Wien.
Der Krimi ist eine formular story, das bedeutet, er beruht auf Konventionen und Klischees. Margit Schreiner meint in einem Interview zu ihrem Roman „Haus, Friedens, Bruch“: „Die Detektive sind Typen (der Grantler, der Fresssüchtige, der Karrierebewusste etc), die Mörder ebenfalls (der Sadistische, der Masochistische, das Opfer, der Böse, der Geknechtete, der Angepasste). […] Der Detektiv mistet den Augiasstall aus, aber er kann das Böse nie und nimmer ganz von der Welt schaffen. Der Leser identifiziert sich mit dem ‚Helden‘, dem Detektiv, der ein Mensch ist wie du und ich. Die Katharsis ist die Lösung des einen Falles. Dazwischen Gesellschaftskritik.“
Wir können Sabine Scholls Giftige Kleider auch lesen als eine leichte Lektüre, die einen schon einmal die eigenen Probleme und die der Welt vergessen lässt. Diese Lesart zeigt einen nicht unspannenden Fall, eine modebewusste Ermittlerin, die Sehnsucht nach Sex (oder Liebe?) hat, und eine Lösung, die mit dieser Sehnsucht korrespondiert.
Sabine Scholl will freilich mehr. Sie will das vorgegebene Muster durcheinanderbringen und ihres vermeintlichen Sinnes entkleiden. Das gelingt, wie sie einmal in einer Vorlesung in der Alten Schmiede in Wien festgestellt hat, indem das Muster in Beziehung gesetzt wird zu anderen Vorgaben, das Muster neu durchmischt wird. Sabine Scholl setzt dabei auf Intertextualität und -medialität. So bilden der Medea-Mythos, die Geschichte der Hashashin, ‚Sound of Music‘ neben vielen anderen Verweisen auf Lieder, Filme und Literatur eine Ebene, auf der der Roman sich selbst als Muster entlarvt. Bedeutungen kommen so ins Schwingen, fix bleibt nix.
Sabine Scholl hat in „Haut an Haut“ vorgeführt, wie Mode das Einnehmen unterschiedlicher Rollen, das dauernde Verwandeln der Person möglich macht. Der beständige Wechsel wird auch in diesem Buch in der Mode-Metaphorik abgehandelt. Mode ersetzt Literatur. „Weniger Geld für Literatur, mehr Geld für Design, weil das internationaler ist; eine Sprache spricht, die alle verstehen.“ Nur dass die Metamorphose eine zum Tod sein kann.
Sabine Scholl hat Humor. Die Beschreibungen der Redaktionsarbeit bei „Metropolitan“, die genauen Beobachtungen in Berliner und Wiener Kaffeestuben und -häusern sind hintergründig vergnüglich. Gina, die schon lange in Berlin lebt und behauptet, das typisch österreichische Denken verlernt zu haben, beschließt bei Wiener Bekannten „Nachhilfe in Abgefeimtheit, Intrigen und übler Nachrede“ zu nehmen. Die Autorin von „Giftige Kleider“ braucht diese nicht.
Apropos Nachrede: Medea kann als Opfer der männlichen Variante gesehen werden. Scholl dreht den Spieß um. Lesart über Lesart also.