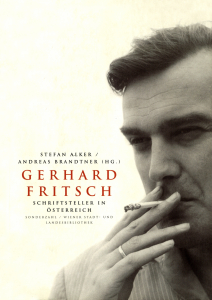Alle wissen, dass Fritsch eine zentrale Gestalt im Literaturbetrieb Österreichs der späten fünfziger und der sechziger Jahre gewesen ist, wenige wissen über sein Werk wirklich Bescheid, viele Details seines Wirkens sind kaum bekannt. Schon gar nicht kannte man seine Arbeitsweise. Die zahlreichen Abbildungen aus Manuskripten, vor allem von Notizen und Entwürfen (z. B. S. 76, 109, 129), zeigen ihn als einen sehr formbewussten und systematisch planenden Erzähler (selbst wenn ihm, was die Beiträge nicht verschweigen, manchmal nur zum Teil gelungen ist, was er vorgehabt hat). Interessant auch die Fotos von einer Fahrt zu den damals noch verfallenden Marchfeld-Schlössern um 1951 (S. 78, 85), offenbar eine ‚Quelle‘ für „Moos auf den Steinen“.
In diesem Zusammenhang seien gleich die (von Stefan Alker und Volker Kaukoreit kommentierten, manchmal überkommentierten) Auszüge aus Tagebüchern hervor gehoben (S. 237-260). Sie lassen menschliche Obsessionen erkennen, die das eine oder andere Motiv in Fritsch‘ Büchern in ein anderes Licht rücken; vor allem bieten sie Einblick in den Alltag eines mühsamen, in der „Einsamkeit inmitten des Lärms“ (S. 242) geführten Schriftstellerlebens. Aufschlussreich sind Beobachtungen über Andere, z. B. über Rudolf Henz (S. 249) oder über Thomas Bernhards „Frost“ (S. 250). Berührend Fritsch‘ Verunsicherung durch andere Ansätze, etwa durch die Lektüre der Essays von Nathalie Sarraute (S. 251), erheiternd eine Beobachtung zur Lieblosigkeit, mit der die Stiasny-Bücherei betreut wurde (S. 251). (Zu den insgesamt sehr nützlichen Erläuterungen: S. 254, Anm. 37: Der erwähnte Gruber kann kaum mit dem Außenminister identisch sein; 256/64: Die Information zum Körner-Preis ist ungenau; 257/83: Der Herr Karl ist von Merz und Qualtinger; 259/110: richtig „Wochinz“).
Da es keine ausgesprochenen Fritsch-Spezialisten gibt, überrascht die durchgehend hohe Qualität der Beiträge; alle Autorinnen und Autoren haben sich intensiv mit dem Werk von Fritsch oder mit gewissen Aspekten davon beschäftigt und keine Zufallsprodukte abgeliefert (wie sie in Bänden dieser Art leider nicht selten sind). Ich kann mich hier im Einzelnen nicht mit den Argumenten der Artikel auseinander setzen, nicht einmal alle nennen; jedenfalls weiß ich nach ihrer Lektüre weit mehr über Fritsch als vorher.
Neben Erinnerungen an den Autor (die von Wieland Schmied sind auch in Hinblick auf Thomas Bernhard von Interesse) und einem biografischen Aufsatz über seine Tätigkeit bei den Wiener Büchereien (von Alfred Pfoser) stehen Urbachs Überblick über die Lyrik von Fritsch und eine ausführliche Darstellung seiner Hörspiele (von Evelyne Polt-Heinzl), verdienstvoller Weise mit genauen Angaben zu ihrer Realisierung. Der Schwerpunkt der literarischen Analysen liegt selbstverständlich auf den Romanen und speziell auf dem Gegensatz zwischen den beiden veröffentlichten Büchern, denen „doch mehr zu entnehmen ist als die Brotkrumen zur Fütterung der intellektuellen Gelüste an österreichischer Geistesverkommenheit“ (Albert Berger, S. 59). Diesen Romanen widmen sich Albert Berger, in einem besonders souveränen Beitrag, Hermann Böhm, Stefan Alker (mit geradezu spannenden Informationen zu den gescheiterten und abgelehnten Romanprojekten zwischen „Moos auf den Steinen“ und „Fasching“, illustriert durch Zitate aus der Korrespondenz mit Verlagen), Raffaele Louis (sehr ins Detail gehend, etwa was intertextuelle Bezüge betrifft) und Alois Brandstetter (zur Verrätselung als Verfahrensweise im nachgelassenen Fragment „Katzenmusik“). Aspekte von Fritsch‘ Rolle im Literaturbetrieb – in dem er eine „fast mythisch anmutende Gestalt“ (Zobl, S. 165) gewesen ist – untersuchen Susanne Zobl (mit Zitaten aus Lekoratsgutachten von Fritsch), Martin A. Hainz und Wolfgang Hackl (über Fritsch und die Literaturzeitschriften). Schmidt-Dengler ordnet schließlich den Schriftsteller in die neueste Literaturgeschichte Österreichs ein.
Die Beiträge sind durchwegs auch im Detail sorgfältig, enthalten sich jedweden Jargons und konzentrieren sich auf ihren Gegenstand. Dass alle Seiten von Fritsch‘ Leistungen berücksichtigt werden, ist ein Verdienst der sorgfältig planenden Herausgeber. Eine Bibliografie der Forschungsliteratur zu Fritsch wäre eine schöne Abrundung des Bands gewesen, doch dazu hat offenbar die Zeit oder eine Verfasserin gefehlt. Auf S. 51 steht „1865“ statt „1866“, „Herkulesbad“ (S. 156) gibt es wirklich (im rumänischen Banat). Sonst sind mir keine Fehler aufgefallen.
Anders als viele zu „Anlässen“ herausgegebene Sammelbände ist dieses Buch keine zufällige Zusammenstellung, sondern ein an Informationen reiches, an Klischees armes Werk, das unsere Kenntnis über Fritsch vertieft, ohne ihn undifferenziert zu preisen. Man spürt darin etwas von dem Respekt, den seine Zeitgenossen dem Autor, dem Herausgeber und dem Menschen Gerhard Fritsch entgegen gebracht haben. Der Ankauf des Nachlasses durch eine bedeutende Handschriftensammlung und seine rasche Bearbeitung haben sich gelohnt.