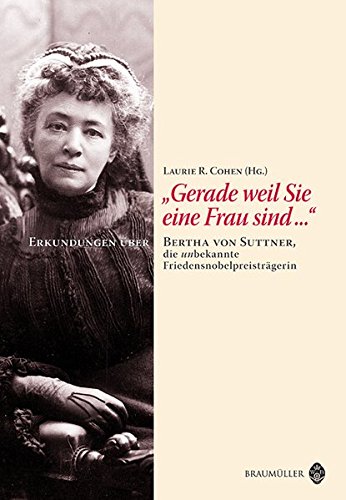Der erste Beitrag stammt von der Herausgeberin und behandelt die Jahre 1876 bis 1883, die das jung verheiratete Ehepaar Suttner im russischen Kaukasus verbrachte. Die wenigen gesicherten Daten über diese Jahre hat Maria Ennichlmair in ihrer Dissertation (2000) sorgfältig zusammengetragen und jüngst in Buchform in der Edition Roesner publiziert. Dass Cohen ihren Aufsatz mit „Aussteiger“ übertitelt und das Kaukasus-Abenteuer als gelebte Maxime der aufklärerischen Forderung nach dem „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ interpretiert, ist eine engagierte, aber leider keine überzeugende Sicht der Dinge. Wenn im Jahr 1876 das ehemalige Kindermädchen des Hauses heimlich den um etliche Jahre jüngeren verbummelten jungen Herrn Baron heiratet, dessen Vater gerade dabei ist, das Familienvermögen durch schlechte Geschäfte durchzubringen, erübrigt sich die Fragestellung „Flucht? Hochzeitsreise? Exil?“, die Cohen in einer Kapitelüberschrift stellt.
Ihr zweiter Beitrag analysiert die politischen Aktivitäten, die Bertha von Suttner und ihr Gatte Arthur Gundaccar nach ihrer Rückkehr nach Österreich in Angriff nehmen. Während sie sich dem Aufbau der österreichischen Friedensbewegung widmet, gründet er eine Vereinigung gegen Judendiskriminierung. Cohen wertet beide Aktivitäten – wie das Bertha von Suttner in ihren Memoiren tut – als konzertierte und vor allem gleichwertige Formen politischen Handelns. Das scheint doch einen wesentlichen prinzipiellen Unterschied zu übersehen: Bertha von Suttner verfügte nicht über das passive Wahlrecht und erlebte auch die Einführung des aktiven Wahlrechts für Frauen 1918 nicht mehr. Schon die bloße Mitgliedschaft in politischen Vereinen war Frauen zu ihrer Zeit generell verboten. Für sie war der mit wenig Durchschlagskraft ausgestattete bürgerliche Verein tatsächlich die einzig mögliche Organisationsform, während ihrem Gatten durchaus alle Optionen politischen Handelns offen gestanden hätten.
Regina Braker untersucht im folgenden Beitrag die Umstände der Verleihung des Friedensnobelpreises und die Gründe, weshalb er ihr, die an seiner Dotierung durch ihre langjährige Freundschaft mit Alfred Nobel wesentlich beteiligt war, erst im fünften Jahr der Verleihung zugesprochen wurde. Weniger aufschlussreich ist der Beitrag von Irmgard Hierdeis „Gefühle und Ahnungen“, der sich im Untertitel zu recht eine „persönliche Revue der Tendenzromane von Bertha von Suttner“ nennt. Es ist keine neue Erkenntnis, dass in den Romanen der bürgerlichen Frauen dieser Zeit der sozialen Frage nicht der ihr historisch zugehörige Stellenwert eingeräumt wurde. Über das, was diese Romane „trotzdem“ an neuen Themen und Fragestellungen einbrachten und wie und wo sie gegen den jeweiligen Zeitgeist opponierten – oft mit nicht unbeträchtlichen persönlichen Folgen, ist mit dieser verengten Perspektive nichts zu erfahren. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass Suttner viele ihrer als Massenware für den Kolportagebuchhandel geschriebenen Romane als bloßen Broterwerb verfasste, um den eigenen Lebensunterhalt zu sichern und den der verarmten Familie ihres adeligen Gatten mitzufinanzieren. Nachdem die meisten Romane Bertha von Suttners heute schwer greifbar sind, ist diese Art der Sichtung eindeutig eine vertane Chance.
Ein wenig erinnert diese verengte Perspektive aus dem Hier und Heute auch an Berührungsprobleme, die feministische Wahrnehmung mit den Vertreterinnen dieser Frauengeneration mitunter hatte. Wenn schon eine aktive Frau der Vergangenheit, dann bitte soll sie aber auch wirklich alle Kriterien der Fortschrittlichkeit erfüllen, was immer gerade darunter verstanden wird. Christine M. Klapeer untersucht in ihrem Beitrag genau diese Ebene der Rezeption der Figur Bertha von Suttners in Österreich nach 1945, wo ihr vor allem im „Bund Demokratischer Frauen“ eine größere Bedeutung eingeräumt wurde. Immerhin wurde 1994 das am linken Donauufer vertäute Schul-Schiff nach Bertha von Suttner benannt, dem Ingrid Schacherl und Iris Steiner einen Beitrag widmen. Der letzte Aufsatz stammt von Josef Berghold und ist eine gediegene und informative Analyse über die zahllosen Karikaturen, in denen Bertha von Suttner – stets böswillig – verewigt wurde. Der Beitrag ist rund und überzeugend – und trotzdem würde man sich gewissermaßen einen zweiten Durchgang wünschen, vielleicht doch von einer Autorin. Was in den abgebildeten Kleider-Attributen, die eine erstaunliche Bandbreite aufweisen, – bis hin zu den gezeichneten Stoffmustern – alles drinnen steht, wäre zweifellos lohnend, herausgelesen zu werden.
Vielleicht liegt es an der Schnelligkeit seines Zustandekommens, dass der Band insgesamt nicht ganz überzeugt und etwas inhomogen wirkt. Ein wenig ist das bedauerlich, denn so schnell wird sich kein Jubiläumsanlass nutzen lassen, heuer Versäumtes nachzuholen.