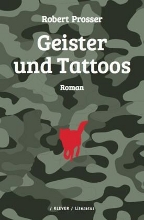Sowohl Strom als auch das zugegebenermaßen schon etwas weniger ausschweifende Feuerwerk waren wilde, hakenschlagende, auf den ersten Blick kaum zu bändigende Texte, bei dessen Lektüre sich unweigerlich das Gefühl einstellte, zu langsam zu sein, buchstäblich nicht hinterher- und das Essenzielle nicht wirklich mitzubekommen, bis man schließlich den richtigen Rhythmus fand, um den trotz ihrer scheinbaren Spontaneität und Willkür höchst durchdachten (Gedanken-)Sprüngen zu folgen und die ihnen zugrundeliegende Ordnung, die sich freilich mehr auf Assoziationen als auf durchgehende Handlungsstränge stützte, zu erkennen. (Dass beide Bücher „trotz“ ihres experimentellen Charakters geradezu flüssig lesbar und ein wirkliches Lesevergnügen waren, machte ihre Qualität aus.)
Geister und Tattoos nun, Prossers aktuelles Werk (und also gleichzeitig sein erster „Roman“), macht dem Leser den Einstieg um einiges einfacher, man findet sofort Zugang, wenngleich auch hier nicht unbedingt immer durchgehend, geschweige denn chronologisch erzählt wird. Thematisch geht es im Roman um die Einwohner einer kleinen Siedlung an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, die nach den Gefechten um Berg-Karabach, an denen die meisten als Milizionäre teilgenommen hatten, beschlossen, den Krieg so weit wie möglich hinter sich zu lassen, einen Neuanfang zu wagen und ihr sprichwörtliches Glück in einem anderen Teil des Landes zu suchen. Dort, im äußersten Norden Armeniens, führen sie nun ein in jedweder Hinsicht abgeschiedenes Leben, unentdeckt, vergessen von den staatlichen Behörden und fernab von deren Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten. Es ist eine archaisch anmutende Gesellschaft, mit ihren eigenen Regeln und Riten, ihren eigenen Mythen und Zaubern, wo Vernunft und Magie gemütlich nebeneinander existieren und es nur ein kurzer Sprung von Medizin zu Medizinmann ist, wie etwa das Beispiel von Avo und seiner Schwester Tamar zeigt: „Der alleinstehende Mittfünfziger hat sich als Widerpart seiner Schwester darauf verlegt, den Aberglauben der Siedlungsbewohner zu bedienen. Unterm Dach treffen zwei unterschiedliche Arten der Vorsorge und Heilung aufeinander, Tamar hortet Medikamente und Verbandszeug, Avo deutet Rauchfahnen und fabriziert aus Fuchsfell und Rabenfedern schützende Talismane.“ Man lebt von Viehzucht und dem, was das umliegende Land hergibt, und begleicht die wenigen notwendigen Anschaffungen mit jenem Geld, das die Männer, die „einer gemeinsam ausgehandelten Reihenfolge entsprechend“ abwechselnd sich als Tage- oder Wochenlöhner in den näher gelegenen größeren Ortschaften verdingen, mit nach Hause bringen. Die restliche Zeit schlägt man mit Kartenspielen sowie mit der Herstellung und insbesondere dem Verzehr von diversen hochprozentigen Destillaten tot.
Den Großteil des Buches (v. a. im zweiten Teil) folgt man einem dieser Bewohner, einem nicht näher definierten „Du“, das den Mittel- und Fluchtpunkt des Romans darstellt, allerdings verharrt die Handlung nicht bei diesem, sondern schweift umher (wenngleich sie auch, früher oder später, immer wieder auf den namenlosen Protagonisten zurückkommt): Erinnerungen vergangener Tage und Taten werden ebenso wie diverse Begebenheiten vor, nach und während des Krieges um Berg-Karabach beschrieben, und auch den anderen Bewohnern samt ihren Schicksalen und diversen Eigenheiten werden ausreichend Platz eingeräumt, sodass man ein eindrückliches und lebhaftes Bild von der Gemeinschaft in der kleinen, abgeschiedenen Siedlung erhält. Nicht nur aufgrund dieser immer wieder eingeschobenen Unterbrechungen nimmt es sich nicht unbedingt einfach aus – noch dazu auf relativ kleinem Raum -, die Geschichte, die erzählt wird, zu rekonstruieren, das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn das eigentlich Bestechende des Romans ist ohnehin seine Sprache: Wie auch schon in früheren Werken überlässt Prosser nichts dem Zufall, schreibt sich, wenn es die Umstände verlangen (und dem immensen Schnapskonsum seiner Charaktere Rechnung tragend), bisweilen fast in einen Rausch, ständig wird der richtige, der einzige auf diese oder jene Sache zutreffende Ausdruck gesucht und ge- bzw. gar erfunden, nichts wirkt gewollt oder gezwungen, jedes einzelne Wort sitzt und geht tief unter die Haut – ähnlich den Nadeln der meist nur behelfsmäßig konstruierten Maschinen, mit denen im Roman die Tätowierungen gestochen werden, die für die Figuren mehr als bloßer Körperschmuck sind: „Er klammert sich an die Tätowierungen und die dazugehörigen Geheimnisse: Alles hier hat mit Schmerz zu tun. Man wächst ins Symbolhafte, trägt Talisman-Tattoos als Schutz gegen Tuberkulose oder Stalinfratzen über dem Herzen, weil kein Soldat oder Polizist auf ein solches schießen wird, glaubt man. Ikonen, Werwölfe, Teufel marschieren auf, weil man zwischen den Welten wechselt, ein Biest sein will und deshalb diese Figuren und Schädel und Schriften auf der Haut trägt. Die Tätowierungen sind Ausweis, Akte, Auszeichnung und Grabinschrift in einem. Man besitzt kein Gesicht mehr, die Merkmale der Familie, der Mund des Vaters und die Nase der Mutter, sind längst von den Ratten gefressen worden, dafür aber hat man diese gepickte, schwarz und blau gemalte zweite Haut. Ein mächtiger, neuer Körper, von den Zellen aufgezwängt.“
Während die Figuren mithilfe von Tattoos also versuchen, etwas Bestimmtes zu bewahren, zu bestätigen, für jeden erkennbar und dauerhaft zu machen, dienen die (ebenfalls titelgebenden) Geister, mit denen weniger übernatürliche Erscheinungen als vielmehr die Unmengen konsumierter Destillate, die „Geistwasser“, gemeint sind, dem entgegengesetzten Zweck, nämlich um vergessen zu können, nicht nur, aber vor allem die Erlebnisse in unmittelbarem Umfeld der vielen Schlachten und Kämpfe, die man im Kaukasus ausgefochten hat und zum Teil noch immer fechtet. Denn auch wenn der eigentliche Krieg vorbei sein und sowohl in räumlicher wie auch zeitlicher Hinsicht längst hinter einem liegen sollte, spürt man in den Dörfern und Gegenden seine Auswirkungen noch immer, auch die Bewohner der Siedlung können – ungeachtet des ausschweifenden Alkoholkonsums – nicht so einfach vergessen, obwohl ihnen doch nur daran gelegen ist, sich „ein Stück Leben [zu rauben], zurückgeholt von Rauschen, Kälte, Wald“. Geister und Tattoos zeigt, wie Menschen trotz widrigster Umstände versuchen, ein menschenwürdiges Leben im gebeutelten Kaukasus führen, und nicht zuletzt deshalb ist es nicht nur ein sprachlich äußerst versierter und großartig komponierter, sondern auch ein hochpolitischer Roman. Man darf gespannt sein, ob Prosser den eingeschlagenen Weg fortsetzt – oder sich gar für einen ganz anderen entscheidet. Zuzutrauen ist ihm jedenfalls viel.