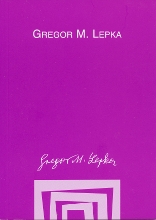Wenn ich also die Gedichte von Gregor Lepka lese, wird deren Wirkung spürbar: Es ist, als ob Gregor Lepkas Weltsicht, seine ganz spezielle Art, in dieser Welt zu sein, diese Welt wahr zu nehmen, sie kritisch und doch liebevoll zu betrachten, es ist, als ob also diese Entwürfe der Wahrnehmung die eigene – meine – Wahrnehmung beeinflussen, kommentieren, sich ihr an die Seite stellen. Ich werde also ein bisschen Gregor Lepka beim Lesen, bewahre ein Stück von seinem „In der Welt Sein“ in meinem eigenen „In der Welt Sein“ auf. Dies ist einerseits möglich durch die kurze Form, andererseits durch den lakonischen Ton, der mehr beschreibend als erklärend persönliche und allgemeine Beobachtungen verbindet. Die Welt mit fremden Augen zu sehen und die eigenen Augen dabei weit offen zu halten, das zum Beispiel machen (diese) Gedichte möglich.
Als eines der großen Themen dieses Gedichtbandes lässt sich die Zeit benennen, die Zeit, die nur eine Richtung kennt und also immer wieder Abschied bedeutet. Der Abschied von der Stadt „Wellington“ unterscheidet sich zwar grundsätzlich vom Abschied von der Kindheit („Mit dem Traum ist es aus“), dieser wiederum ist ein anderer Abschied als jener von einem vergangenen Jahr („Das Weiß des Schnees wirkt wie eine Drohung“) – und doch haben sie alle gemeinsam, dass sie die Unumkehrbarkeit der Zeit thematisieren, jene Unumkehrbarkeit, die den Weg zurück in die Kindheit ebenso versperrt wie jenen zurück ins vergangene Jahr – und was die Stadt Wellington betrifft, so wissen wir, dass es sie zwar gibt, aber, sobald wir Abschied genommen haben, eben „ohne uns“. So schwingt in jedem dieser beschriebenen Abschiede, die gelebt werden (müssen), jener Abschied mit, den wir nicht leben müssen, nach dem es aber (fast) alles gibt – „ohne uns“. Das ist das eine große Thema, das in dieser Zusammenstellung zum Tragen kommt, ich nenne es „traurige Beharrlichkeit“, oder, besser vielleicht, ein beharrliches „Trotzalledem“, ein Festhalten gerade der Bruchstücke, der Verluste, die, so könnte man vielleicht sagen, in Sprache gebannt eine neue Präsenz gewinnen – Erinnerung als Zurückrufen und Neugestaltung der erinnerten Inhalte. Und: Verluste sind möglich, weil es etwas zu verlieren gab und gibt, ja: „Langsam sterben die Meere und unsere Sonnen“.
Damit bin ich schon bei dem zweiten großen Thema dieses Lyrikbandes: Es ist dies der Ausdruck einer persönlichen und politischen Unzufriedenheit, eines Nicht-Einverstanden-Seins mit dem Zustand der Welt, eine Verzweiflung, die auf historische Ereignisse Bezug nimmt, zugleich auch über diese hinaus weist, dorthin, wo die „Wanderung in die Angst“ startet, in eine Angst, die nicht näher bezeichnet wird, die aber durchaus in Verbindung steht mit dem Entsetzen jenes Gedichtes, in dem „noch immer Bomben über Vietnam“ fallen oder der Verzweiflung des Gedichts über Kriege, die „hinter den Bergen“ geführt werden. Ja, die Gedichte halten die Welt fest, damit sie nicht bleibt, wie sie ist. Punktum.
Zwischen den beiden skizzierten Themen des Bandes sehe ich den Dichter Gregor Lepka balancieren. Und dieses Balancieren lässt Platz für viel Humor, nüchterne Gelassenheit und ein schelmisches Lachen: „Was mich erfreut an / unserer Katze? Daß sie / nicht bellt wie ein Hund.“ So heißt es in einem der sieben Katzenhaikus. Wer würde hier nicht schmunzeln über die tiefe Wahrheit, die mit einem Augenzwinkern den Katzen und Hunden gleichermaßen gerecht wird? Denn, wie gesagt „Die Welt schließt alles ein“.
Gregor Lepka hat Fußnoten zur Weltgeschichte geschrieben, lakonische und knappe Kommentare, Beobachtungen und Bemerkungen, die zuweilen mit einem Gedankenstrich enden, gewissermaßen also kein Ende haben. Ja, die Weltgeschichte braucht Fußnoten, in denen sie sich selbst reflektieren kann, in denen die Gedanken Platz haben, sich um sich selbst zu drehen oder um die Erde, den Mond, die Sonne oder die Eisblumen am Fenster, denn: „Unsere Gedanken suchen eine noch mögliche Welt“, heißt es im Gedicht mit dem Titel „Suche“.
Christian Teissl zitiert in seinem Vorwort aus einem Interview, in dem Gregor Lepka über den von ihm überaus geschätzten Autor W.H. Auden das Folgende sagt: „Ich bewundere die Art, wie er in fast allen seinen Gedichten das Allgemeine und Persönliche zu verbinden versteht (…)“ Genau dies ist es, was auch in Gregor Lepkas Gedichten auf ganz besondere Art gelingt: das Allgemeine wird zum Persönlichen und damit zum Besonderen.