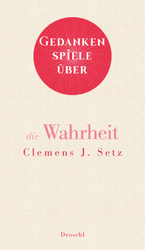Aber das braucht „die schöne Leserin/den schönen Leser“ (Musil) nicht zu interessieren. Also ein zweites Mal lesen. Sind eh nur 44 Seiten. Es geht immerhin um Wahrheit. Und zwar um Wahrheit der Worte. Das heißt: um die Art Wahrheit, die sich in Sprache, in Zeichen manifestiert. Es handelt sich um einen philosophischen Essay. Die Leserin/der Leser stelle sich Clemens J. Setz vor, im Literaturhaus bei der Lesung. Setz, wenn er zu einer Lesung geladen ist, liest ja bekanntlich nicht, sondern er erzählt. Jetzt hat er endlich den perfekten Text dazu. Ein Büchlein, pro forma in fünf nummerierte Kapitelchen unterteilt, bestehend aus lauter kleinen Geschichten. Das kann er an einem einzigen Leseabend in einem herunter erzählen. Anekdoten über die Wahrheit, die Wahrheit anekdotisch, aphoristisch. Klein ist sie, die Wahrheit, und sie liegt in den Worten. Es beginnt mit falsch/richtig. Die falsche Erinnerung an die richtigen Worte. Doch die – gar nicht von Setz, sondern von Roger Willemsen – aus Grillparzers Tagebuch schlecht erinnerten Worte, in die der Wiener Binnenlanddichter seinen spät erfahrenen ersten Eindruck vom Meer fasst („So hatte ich’s mir nicht gedacht“), erweisen sich als die wahren Worte. Die falsche Erinnerung ist wahrer als die richtigen Worte. Ausschließlich geht es um die Wahrheit innerhalb der Erzählung, der Erinnerung, der (Re)Konstruktion. Das heißt, nicht wie es wirklich gewesen, sondern wie es richtig geschrieben sei. Zum Beispiel die Geschichte über die Gottesleugnerin im 14. Jahrhundert. (Siehe Leseprobe)
Was ist der Sinn?
Das nicht zu fragen, ist vielleicht gerade der Sinn. Meine Parallellektüre zu den Gedankenspielen über die Wahrheit von Clemens J. Setz sind die Auslassungen von Roland Barthes in seinem Japan-Buch Das Reich der Zeichen (L’empire des signes, aus dem Französischen von Michael Bischoff, edition suhrkamp, 1981) über die literarisch-philosophische Textgattung des Haiku. Was Barthes über den Haiku sagt, trifft im Grunde genommen auch auf die kleinen Geschichten von Setz über die Wahrheit zu. Darum zitiere ich hier ausführlich genug Barthes als Erklärung von Setz‘ Zugang zur Wahrheit: „Im Haiku ist die Beschränkung der Sprache Gegenstand einer Anstrengung, die uns unbegreiflich ist, denn es geht nicht um konzisen Ausdruck (d.h. den Signifikanten möglichst knapp zu fassen, ohne die Dichte des Signifikats zu verringern), sondern im Gegenteil darum, auf die Wurzel des Sinns einzuwirken, um zu erreichen, daß der Sinn sich nicht erhebt, sich nicht verinnerlicht, sich nicht einschließt, nicht ablöst, sich nicht ins Unendliche der Metaphern, in die Sphären des Symbols verliert. Die Kürze des Haiku ist nicht formaler Natur; der Haiku ist kein reicher Gedanke, der auf eine kurze Form gebracht wäre, sondern ein kurzes Ereignis, das in einem Zuge seine richtige Form findet.“ (S. 103)
In einem Zug die richtige Form zu finden, darum ist es auch Setz zu tun. Ein sprachsensibler Mensch wie er, ein „Künstler als junger Mann“, um mit Joyce zu sprechen, erinnert die einst gelesenen Sätze stets in der kürzeren, in der richtigeren Form. Seine Gedächtnis schleift die Worte ab, schmälert das große Blabla zur schlichten Wahrheit. Wenn Setz übrigens bei der Lesung erzählt, was er geschrieben hat, tut er das, was als einziges Verfahren zur Deutung des Haikus taugt: es noch einmal zu lesen, noch einmal zu sprechen, als Wiederholung, als Echo. Im Haiku ist die Wahrheit nicht tief, nicht komplex, nicht relativ, nicht widersprüchlich, wie wir immer behaupten. Alle kleinen Geschichten, die Setz erzählt, sind genau das Gegenteil. Das hat mich die Lektüre des kleinen Büchleins gelehrt, und das ist viel.