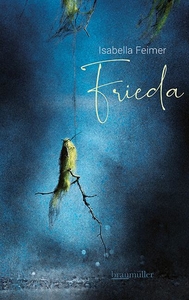Feimers Souveränität als Autorin zeigt sich etwa im gekonnten Spiel mit erzählter Zeit und Erzählzeit: Während die wenigen Stunden des letzten Abends der Protagonistin gedehnt werden, sind die Passagen aus ihrer Jugend stark komprimiert dargestellt. Eine jahrzehntelange Vergangenheit wirkt dadurch rasend schnell verflogen, während die Gegenwart des Sterbens sich grausam hinzieht. Eindringlicher könnte das schmerzhafte Erleben von Alter und Krankheit kaum verdeutlicht werden.
Die Komposition des Romans erinnert an ein Musikstück: Leitmotivisch kehren einzelne Symbole ständig wieder, zum Beispiel die Silbertanne, der Schnee, die Herbstzeitlosen oder der Feuersalamander. Alle sind völlig stimmig der Erfahrungswelt von Frieda entnommen, die auf dem Land aufgewachsen ist, selten die Grenzen ihres Dorfes verlassen hat und von Kindheit an der Natur nahe war. Einprägsam macht Feimer das Delirium der Sterbenden spürbar, wenn jene Leitmotive zwischen Gegenwart und Erinnerung hin- und herwandern, regelrecht irrgeistern: Vermischt die alte Frau die Silbertanne, die sie vor ihrem Krankenhausfenster sieht, mit der Erinnerung, oder spielte dieser Baum in ihrem Jugenderlebnis tatsächlich eine besondere Rolle? Ist sie nur verwirrt und bringt alles durcheinander? Sieht die Krankenschwester wirklich ihrer Jugendfreundin ähnlich oder legt sich hier bereits die trostsuchende Fantasie über die Wahrnehmung der Realität? Einzelne Sätze und Dialogfetzen wiederholen sich im Laufe des Romans wie ein Refrain, teilweise mit leichten Variationen, sodass beim Lesen häufig die Frage auftaucht: Wie war es wirklich? Stimmt jene Version des Dialogs oder die andere, wie hat das Gespräch tatsächlich stattgefunden?
Die Rückblenden tragen die Protagonistin und das Lesepublikum zurück in eine Jugend während des Zweiten Weltkriegs. Frieda wächst in einem Dorf in Niederösterreich auf, ihr Bruder und ihr Verlobter kämpfen an der Front, der Vater ist vom Einsatz im Ersten Weltkrieg traumatisiert, wurde zum Alkoholiker und verhält sich herrschsüchtig und gewalttätig gegenüber seiner Familie. Auch zur Mutter ist das Vertrauensverhältnis zerstört, nachdem Frieda mitansehen musste, wie diese dem Wirten ihren Körper anbot, um in der Zeit der Armut die Familie zu ernähren. Die warmherzigste Beziehung in Friedas Leben ist jene zur Nachbarstochter Grete. Leise deutet Feimer eine romantische Dimension dieser Freundschaft an, ohne aber je zur Gänze preiszugeben, wie viel davon bloß Wunsch und Fantasie oder tatsächlich Realität war. Wieder bleibt ein Zweifel zurück: Ist die von Schmerzen geplagte Sterbende in ihren letzten Stunden eine unzuverlässige Erzählerin, was dürfen und sollen wir ihr glauben?
Lesenswert ist der Roman nicht bloß wegen der Freude an der Komposition und der Feinheit der Sprache, sondern auch wegen der scheinbar beiläufig eingestreuten Erkenntnisse, die sich aus der Erfahrung eines rauen, kargen Lebens speisen: „kennst du das, Frieda, fragte Mitzi, wenn du dich so hilflos fühlst, dass es dich stärker macht?“ (S. 73-74) In einer Welt mit sehr engen Grenzen, die nur wenig Möglichkeiten zum Ausbruch bietet, bleibt den Figuren kaum mehr als ein kühler Pragmatismus: „Dass das Überleben immer eine Entscheidung ist, die getroffen werden muss, denkt Frieda und spürt, dass ihr Atem wieder ruhiger ist und der Krampf in ihrem Inneren sich löst, denkt an eigene Entscheidungen, sie hat den Hunger überlebt, indem sie ihn verleugnet hat […]“ (S. 116)
Viele Bilder sind so treffend, dass sie noch lange über das Lesen hinaus im Gedächtnis bleiben, etwa die Schneeflocken, die Frieda als Mädchen in einem Glas sammeln möchte, um sich den Winter zu bewahren. Später fragt ihre Schwester sie, weshalb sie denn bloß ein Glas mit Wasser aufhebe. Gekonnt macht Feimer damit anschaulich, was während des Romans auch mit Friedas Erinnerung geschieht: Im Versuch des Aufbewahrens verändert der Gegenstand seine Form; was von der Vergangenheit zurückbleibt, wird als trügerisch entlarvt.