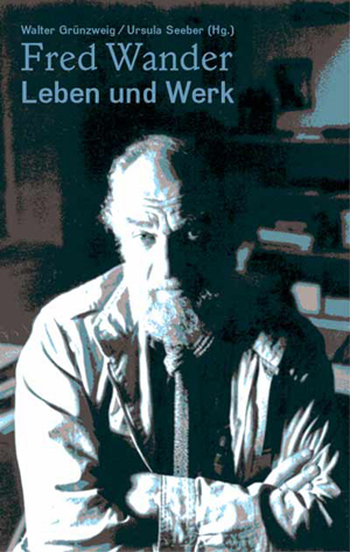Am Beginn stand mein Versuch, den Autor selbst zu befragen; zu diesem Buch über ihn; ihn zu einer Aussage, zu einem Kommentar oder vielleicht sogar zu einer Bewertung zu bewegen. Fred Wander hat es bisher offenbar nur quergelesen; die für ihn typische Zurückhaltung und Bescheidenheit trägt möglicherweise dazu bei. Die Tatsache, dass seinem Leben und Werk – wie es im Titel heißt – ein Buch mit Beiträgen gewidmet ist, das ist dem zurückgezogen lebenden Autor selbst nicht ganz genehm. Und vielleicht auch nicht ganz geheuer. Aber so ist er, in der vorderen Reihe zu stehen, liegt ihm nicht, irritiert ihn, vielleicht hat er ob dieses Charakterzugs (neben einer Portion Glück) auch die Vernichtungslager des „Dritten Reichs“ überlebt. Andeutungen in diese Richtung hat er mir gegenüber oft gemacht. Ich konfrontiere Fred Wander mit der Erkenntnis, dass ich wohl wusste, dass er unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien als Journalist tätig war, aber von seiner Arbeit als Dramatiker nichts gewusst hätte. Was doch ein Verdienst diese Buchs sei, oder?
Denn damit beschäftige sich ein Beitrag des Buchs – verfasst von Klemens Renoldner: „Versuche mit der Gegenwart. Zu den Theaterstücken Fred Wanders.“ (Im zweiten Teil des Buchs unter den „Analysen“ zu finden) Fred lacht etwas matt, wie wenn ihm das Interesse an seiner Theaterarbeit in der ehemaligen DDR selbst nicht ganz geheuer wäre, dann meint er: „Ich hätte mich hineinknien können, vielleicht wäre dann noch ein größeres Stück entstanden, aber ich bin eigentlich kein Dramaturg, ich bin ein Geschichtenerzähler!“
Das Verdienst dieses Berichts ist die Recherche. Klemens Renoldner erzählt, welches Stück Fred Wanders – wo und zu welcher Zeit, von wem – aufgeführt wurde. Er analysiert, wieweit sich die Inhalte von Wanders Theaterstücken „Josua läßt grüßen“, „Bungalow“, „Das taubengrüne Haus“ „Patrique, Patrique“ auch auf die gesellschaftliche Realität in der DDR beziehen lassen, wieweit sie aber auch die Widersprüche der Nachkriegsgesellschaften schlechthin thematisieren. Es entsteht der Blick in das Kulturleben eines Staates, dessen Selbstverständnis es war „der bessere der beiden deutschen Staaten“ gewesen zu sein. In diesem Staat – das ist eine der wenigen positiven Seiten jener eigenartigen „Diktatur des Proletariats“ – hatte ein Autor wie Wander einen Platz gefunden, nota bene: Nicht im „jungdemokratischen“ Nachkriegs-Österreich . Was auch einiges über die jahrelange kulturelle Gleichgültigkeit des offiziellen Österreich sagt. Bis 2005 ein „Gedankenjahr“ ausgerufen wurde.
Interessant liest sich auch die Geschichte der Vereitelung eines DDR-Filmprojekts von Eberhard Görner, der Fred Wanders bedeutendsten Roman „Der siebente Brunnen“ verfilmen wollte. Mit dabei wäre damals – auf Grund einer Initiative des verstorbenen Intendanten Wolf in der Maur – auch der ORF gewesen. Görner beschreibt an Hand von Briefen „die Geschichte eines Films, der nie gedreht wurde“. Er demonstriert am Beispiel seines Filmprojekts – sowohl im positiven als auch im negativen Sinn – die Staatsnähe der DDR-Kulturschaffenden als auch ihre Ausgeliefertheit. Und er verschweigt auch nicht, was sein Projekt letztlich vereitelte: Die DDR wollte nicht zu viel Aufsehen mit dem namenlosen „widerstandslosen“ Leid der jüdischen Häftlinge machen, dem „ersten antifaschistischen deutschen Staat“ kam es auf den „aktiven Widerstand“ der „Politischen“ an. Bücher wie „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz, die diese „conditio sine qua non“ erfüllten, wurden verfilmt, Wanders „Der siebente Brunnen“ dagegen nicht. Ob eine eventuelle Verfilmung dem Autor gefallen hätte, darf getrost bezweifelt werden.
Welche journalistischen und literarischen „Fingerübungen“ Fred Wander in den fünfziger Jahren vollbracht hat, um langsam aber sicher zum eigentlichen Ziel, dem Roman, vorzudringen, ist Teil von zwei interessanten Recherchen.
Da ist einmal der Bericht von Christine Schmidjell (Titel: „Das Brot der Geschichtenschreiber liegt auf der Straße“). Er beleuchtet den „Sozial-Reporter“ Fred Wander, der sich mit Alltags- und Menschengeschichten im Wien der fünfziger Jahre auseinandersetzt. Der in der linken Boulevardzeitung „Der Abend“ sowie in der kommunistischen Presse Berichte veröffentlicht, die schon mit einer Dramaturgie jenseits rein journalistischer Aufbereitung arbeiten. Schade nur, dass kein Faksimile aus den Zeitungen abgedruckt ist, in denen Fred Wander seine Reportagen über Selbstmörder, Straßenbahnerinnen und so genannte Sesselfrauen veröffentlichte. Jedenfalls scheint sich Fred Wander mit der Zeit warm geschrieben zu haben, er antizipiert geradezu seine schriftstellerische Existenz. In seiner Wiener Zeit habe Fred Wander, so zitiert die Autorin aus dem Roman „Das gute Leben“, so etwas wie „eine neue Beziehung zur ganzen Welt“ aufgebaut.
Auch Walter Grünzweigs Essay „Sinnbilder des Lebens“ widmet sich den literarischen „Fingerübungen“ des Fred Wander, setzt sich mit dem „Jugendbuchautor“ Wander auseinander. Form und Dramaturgie deuten schon auf die späteren Werke hin, aber die menschliche Ausnahmesituation der Vernichtungslager der Nationalsozialisten wird noch in Abenteuergeschichten „chiffriert“; wie „Taifun über den Inseln“, ein Jugendbuch über das Überleben in der philippinischen See. Von der Struktur ist hier schon vieles vorweg genommen, wie Grünzweig demonstriert, hat aber noch nicht die Meisterschaft des „story-telling“ wie seine späteren Romanen, die insgesamt autobiographische Züge tragen.
Ein kleines Meisterstück ist der Essay von Gerhard Kofler: Er analysiert nicht nur, er deutet Kunst aus, das was man bei der Lektüre von Fred Wanders Roman „Der siebente Brunnen“ spürt, wird von Kofler meisterhaft in Beziehung zu Primo Levis Romanen gestellt, gewürdigt und so in einen größeren Zusammenhang gebracht. Kofler demonstriert, dass Wanders Methode der Anteilnahme viel mehr ist als der oft beschworene und geforderte Heroismus in den Konzentrationslagern; dass das Nicht-Vergessen der Lebens- und Sterbensgeschichte, dass das Erinnern eine Form der Würdigung der Anstrengung der Ermordeten ist. Kofler vermittelt, dass Wander keine verkappten Happy Ends produziert und produzieren kann, vielmehr dramaturgisch effektvoll nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ schreibt: emphatisch den Lebenswillen der Überlebenden angesichts des Todes und dem Entrinnen der Todesmaschinerie des Hitlerregimes festzuhalten, bewahrt den Schriftsteller Fred Wander vor aller Gefahr in einen literarisch-pathetischen „Holocaust-Kitsch“ abzugleiten.
Fred Wander. Leben und Werk ist ein Buch, das all denen empfohlen sei, die bereits Wanders Romane gelesen haben. Und sollte jemand das Buch vor der Lektüre der Romane „Der Siebente Brunnen“, von „Hotel Baalbek“ und „Ein Zimmer in Paris“ lesen, wird er hoffentlich das Buch zeitweilig weglegen und sich zuerst die Romane Wanders besorgen.