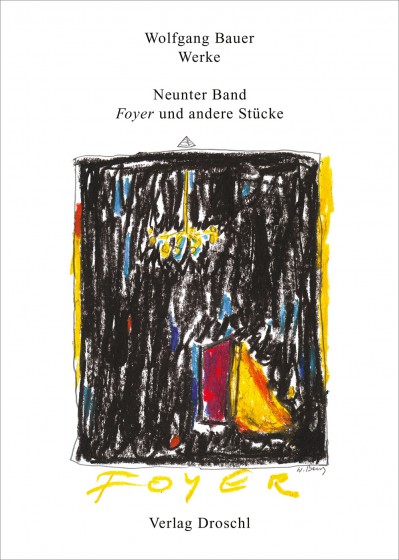Mit gesellschaftskritischem Scharfsinn legte Wolfgang Bauer in seinen Stücken aus den späten sechziger und frühen siebziger Jahren die Sinnlosigkeit und Ausweglosigkeit der Zeit offen, die von der sprachlichen und geistigen Trivialität der die Gesellschaft beherrschenden Medien geradezu gekennzeichnet war. Dazu kam seine Experimentierfreude mit der Sprache und den Formen des Theaters. Durch die Demontage von dramatischen Kategorien, durch die Banalisierung der Sprechtexte und das Spiel mit den Erwartungshaltungen des Publikums erzielte er jene Abweichungen von den etablierten Theaterkonventionen und -normen, die als Störung und Provokation aufgefasst wurden. Diese avantgardistische Praxis gehörten zu den Phantastereien eines Wolfgang Bauer, mit denen er seinen gesellschaftspolitischen Beitrag leisten wollte.
Seither ist mehr als ein Viertel Jahrhundert vergangen und mittlerweile sind neun Bände zu Wolfgang Bauers literarischem Werk beim Grazer Droschl-Verlag erschienen. Im letzten Band der Werkausgabe meldet sich der Autor wieder als Dramatiker zu Wort, wobei er sich in den Texten unterschiedlicher dramatischer Ausdrucksformen bedient: Als Theaterstücke werden Foyer (2004) und Café Tamagotchi (1998) ausgewiesen, Dream Jockey (1996) als Hörspiel, Café Museum (1993) als Opernlibretto, und das kurze Stück Ein schrecklicher Traum (1987) ist wohl als Dramolett zu bezeichnen. Bauers dramatische Produktion seit Mitte der achtziger Jahre ist also relativ bescheiden. Ebenso ist auch die jeweilige Originalität der einzelnen Texte zu beurteilen, die trotz der zeitlichen Differenz ihrer Entstehung recht ähnliche Themen behandeln und für wenig Abwechslung in den poetischen Techniken sorgen. Zumal drängt sich der Verdacht auf, dass dem Magic Wolfgang die Phantasien ausgegangen sind und er einfach in jedem Stück nur das „banale Laufenlassen“, das zum poetischen Programm seines Schreibens geworden ist, vor Augen führt. Der Autor mag daran zwar seine Freude finden, als Leser stellt sich aber bei mir dann eine gewisse Ungeduld ein, vor allem wenn an sich gute literarische Einfälle in platten Bildern oder primitiven Witzen ersticken.
In Bauers jüngstem Stück Foyer, das im Herbst 2004 im Rahmen des „steirischen herbstes“ uraufgeführt wurde, ist das dramaturgische Konzept durchaus spannend: Ein Dramatiker namens Charlie Dodler möchte der Uraufführung seines autobiographischen Stücks „Mein tolldreistes Leben“ beiwohnen, hat allerdings die Eintrittskarte für sein eigenes Leben vergessen und muss demnach, wie der Name des Stückes verrät, im Foyer des Theaters verweilen. Mit Charlie Dodler bleibt auch das Publikum vom eigentlichen Theaterstück ausgesperrt, nur ab und zu kann es in Erfahrung bringen, wer die Figuren seines Stückes sind und welche Handlungselemente es beinhaltet. Das ist natürlich nichts Neues, schon in „Party for Six“ wurden die Zuschauer nur bis zum Vorraum vorgelassen. Indem Bauer das Geschehen allerdings in das Theater verlegt, werden Reflexionsräume geschaffen, welche die Rolle von Bühne und Theaterbetrieb neu verhandeln. Die Zuschauer begeben sich also mit dem Autor auf die Suche nach dessen Stück und somit nach dessen Leben. Die zeitlichen Ebenen beginnen zu verschwimmen, ebenso wie die Grenzen zwischen realen und fiktiven Theaterräumen. Es drängt sich immer wieder die Frage auf, wo sich nun das eigentliche Stück abspielt. Auf der realen oder fiktiven Bühne, im wirklichen oder erfundenen Leben, oder doch nur im Kopf? Es ist ein Spiel im Spiel, das Wolfgang Bauer mit seinem Charlie Dodler zu entwickeln vermag, in das er sich jedoch immer mehr verwickelt und verstrickt, sodass als Ausweg nur eine Ego-Transplantation übrig bleibt: Dem Autor wird zuerst „der Blinddarm herausgerissen … und dann in einer grotesken, äußerst realistischen Szene wieder in seinen Kopf eingebaut […]. Im Albtraum kommt ihm die Idee für ein geniales Theaterstück … nämlich, daß sein Leben das Theaterstück selbst ist und sich aus sich selbst dauernd erneuert.“
Ist der Blinddarm nun einmal dort implantiert, wo sonst die Kopfgeburten des Autors entstehen, scheint alles erlaubt zu sein: Ein paar Nackte dürfen dann nicht fehlen, deshalb lässt der Regisseur als Teufel noch schnell recht unmotiviert seine Hose runter und auch Dodlers Frau muss nach ihrem Geschlechts-Akt mit Albees Ziegenbock noch unbekleidet über die Bühne laufen. Als Draufgabe wird Charlie Dodler, der inzwischen zu Shakespeare mutiert ist, das Herz vom Präsidenten Bush (oder war es doch von Hermann Maier?) als amerikanisches Ego eingepflanzt. Als multiple Persönlichkeit kann er sein Stück nur im Amoklauf beenden: Er schießt auf seine Figuren, zertrümmert sein Stück, um eigentlich nur sich selbst zu töten. Zum Schluss liegt er „zerrissen“ auf dem Boden, so ist er auch mit seinem Stück endlich ans Ende gekommen.
Es ist der Albtraum eines Autors, den hier Wolfgang Bauer literarisch verarbeitet. Dem realistischen Phantasten der späten sechziger Jahre dürfte das Vertrauen in die Wirklichkeit abhanden gekommen sein und er dürfte sein Interesse nunmehr auf surreale Traumwelten, Halluzination, Visionen und Wahnvorstellungen verlegt haben. Das verheißen auch schon die Titel der beiden Texte „Ein schrecklicher Traum“ und „Dream Jockey“. Im ersten Stück geraten die Ebenen zwischen Traum und (medialer) Wirklichlichkeit im „Amte für Traum“ durcheinander, der zweite Text lässt in einer Radiosendung Zuhörer zu Wort kommen, die über ihre Träume berichten. Das Hörspiel soll wie eine Live-Sendung wirken, wobei auch die privaten Gespräche des Radiosprechers mit seinen Kollegen zu hören sind. „Alles in allem ist aber“, wie Bauer in der Regieanweisung erklärt, „sowieso [nur] ein Traum“. Das scheint auch für „Café Museum“ und „Café Tamagotchi“ zu gelten, in beiden Texten werden Szenen aus dem Kaffeehaus in Traumwelten verwandelt und diesen gegenübergestellt. In „Café Museum“ wird der explizit als ein Irrer ausgewiesene Bosco von Malta seinen Wahnvorstellungen erliegen und auf seine Erleuchtung warten. Das Chaos, das er verursacht, kann nur mit Hilfe der Polizei beseitigt werden. Der Text ist vom Aufbau gleich angelegt wie „Café Tamagotchi“, in dem wir mit einer technisierten Scheinwelt konfrontiert werden. Als Grenzgänger zwischen Illusion und realer Welt ist die Figur des Blackhole angelegt, seine Schizophrenie lässt ihn schließlich wie Charlie Dodler zur MP greifen. Doch er trifft nichts und niemanden, nicht einmal er kann sich in den Tod retten. Zum Schluss weiß aber keiner so recht, was hier eigentlich gespielt wird.
Bauer scheint sich in seinen Traumlandschaften zu verlieren. Die skurrilen Bilder, die er entwirft, sind zum Teil nichts anderes als Trash, und die pornographischen Einlagen regen auch schon längst niemanden mehr auf. Um Leser und Zuschauer heute zu provozieren, bedarf es schon anderer Mittel als jener, mit denen der junge Wolfgang Bauer punkten konnte. Mich interessiert vor allem ein Wolfgang Bauer, der den Gegensatz zwischen Wirklichkeit und Fiktion aufzulösen vermag, der den Begriff der Mimesis neu beleuchtet und dabei immer wieder an die Grenzen des Darstellbaren stößt. Die Lösung dabei im Traum, in dem scheinbar alles erlaubt ist, zu suchen, ist meines Erachtens aber ein recht billiger Weg. Der Traum kann ruhig ein Hilfsmittel beim Schreiben sein, aber eben nur ein Hilfsmittel.