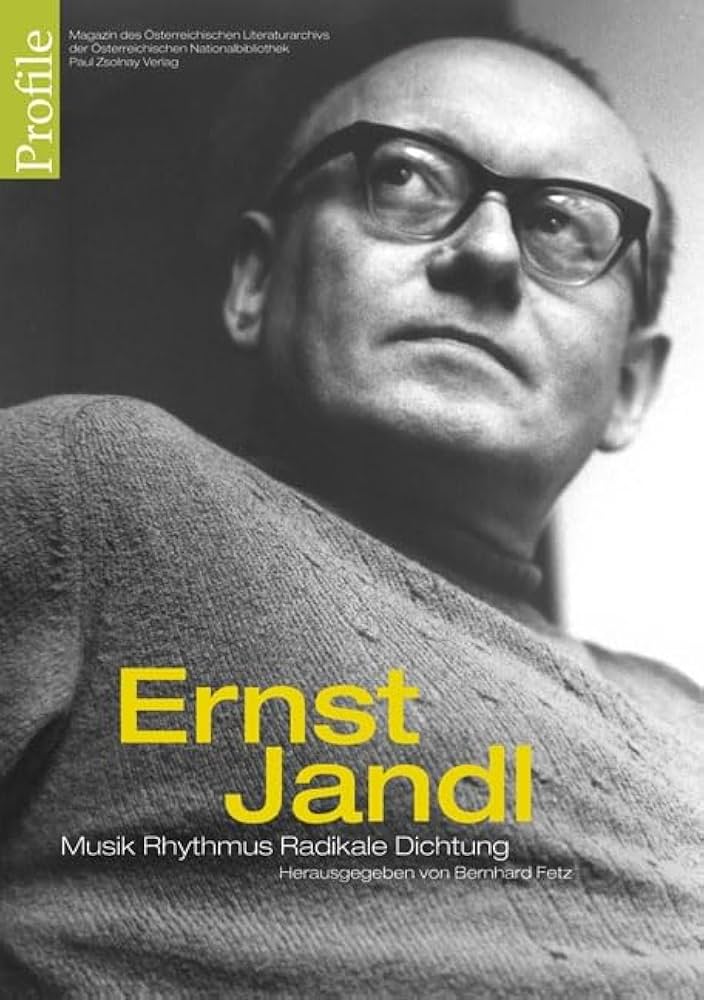Der berufsbedingt distanzierte Blick der Germanisten bestätigt im wesentlichen einige Thesen, die nicht neu sind, an denen man sich aber noch lange, angesichts der Materialfülle des Jandlschen Oeuvres, wird abarbeiten dürfen. Ernst Jandl zwischen Sprachspiel und Mimesis, zwischen Realismus und Avantgarde, zwischen dem Handwerk der sogenannten konkreten Poesie und einer Art Egomanie, die den am eigenen Leib erfahrenen Verfall protokolliert. Ernst Jandl, ein experimenteller Dichter nicht nur im Sinn der experimentellen Literatur, sondern auch insofern, als er sich nie mit dem Erreichten zufrieden gab, sondern neue Sprechweisen und Sprachen ausprobierte, in Depressionen schlitterte, sich wieder herauskämpfte.
In einem poetologischen Fragment aus dem Jahr 1970 („Zum Thema ‚Autorität des Wortes'“) zeigt Jandl eine ganz auf den technischen Aspekt des Herstellens von Texten orientierte Sprachauffassung: „Wörter sind Dinge, Wörter haben keine Macht, aber ich kann sie verwenden, um Macht zu erreichen und auszuüben.“ Diese Perspektive entspricht einer zu jener Zeit recht verbreiteten Auffassung von Technik als neutralem Instrumentarium, das zu guten wie zu schlechten Zwecken verwendet werden kann. Bei Jandl geht der technische Optimismus mit einem Urvertrauen in die mimetische und kommunikative Funktion der Sprache einher: Wirklichkeit läßt sich ohne weiteres abbilden, auch durch ein Lautgedicht, und was ich mitteilen will, kann vom Empfänger ohne Störungen oder Verluste aufgenommen werden. Sprachzweifel, wie sie von Hofmannsthal und Wittgenstein um die Jahrhundertwende formuliert wurden, waren Jandls Sache nicht – jedenfalls nicht bis zu der Krise, die ihn Ende der siebziger Jahre, als sich die experimentelle Nachkriegsliteratur erschöpft hatte, ereilte. In Profile 12 ist ein späteres Jandl-Gedicht abgedruckt, das mit jener „heruntergekommenen Sprache“ hantiert, die man wohl als Ausdrucksform jener poetisch-existentiellen Krise interpretieren darf. Die Beschreibung fortschreitender Aphasie in diesem Gedicht („vom leuchten“) erinnert durchaus an die Aphasie des Lord Chandos, samt den quasi mystischen Erlebnissen und Mitteilungen jenseits der Sprache: „dann du vielleicht werden anfangen leuchten, zeigen in nachten den pfaden denen hyänenen, du fosforeszierenen aasen!“ Noch der Kadaver von Jandls Dichtung leuchtet, er zeigt den Weg als wortloses Zeichen. Wenn wir den Text so lesen, müssen wir freilich uns, die Leser, als Hyänen hinnehmen. Wir fressen, was von Jandl übrigbleibt. Und Profile 12 ist in diesem Sinn eine Aufforderung zum Mahl.
Wendelin Schmidt-Dengler beschreibt in seinem Beitrag Jandls Wege zwischen experimenteller Literatur und „Rückkehr des Ich“, und Daniela Striegl sondiert, andere „alte Dichter“ wie Rühmkorf oder Bisinger zum Vergleich herbeizitierend, die Verzweiflungen und Exzesse, die „Alterslüste“ und Grobheiten des Dichters, der seine Energien dahinschwinden sah und mit den Mitteln der in die leib-seelischen Niederungen heruntergebrachten Dichtkunst gegen den Verfall aufbegehrte. Das alles habe mit der Autorenbiographie nichts zu tun, meinen Germanisten, die der Konjunktur textanalytischer „Ansätze“ folgen: „Jandl betreibt ein Vexierspiel. Es geht ihm nicht um die Rekonstruktion biographischer Einwirkungen. Durch den Text vibriert nur bei oberflächlicher Lektüre Autobiographie.“ (Die Rede ist von der Sprechoper Aus der Fremde.) Eine Tiefenlektüre wird es schaffen, das Biographische endgültig auszulagern. In schärfstem Gegensatz dazu beginnt Klaus Kastberger seinen mit dem Satz: „Ja, es ist die Wohnung Ernst Jandls in der Wiener Wohllebengasse, die in der einleitenden Szenenanweisung der Sprechoper Aus der Fremde in vielen erkennbaren Details beschrieben wird.“ Oliver Ruf hingegen glaubt in Jandls Erwähnung des Baujahrs 1910 eine „kulturgeschichtliche“ Anspielung auf die historische Avantgarde, die er in seinem Text „destruiert“ (dann auch „dekonstruiert“), erkennen zu sollen. Kastberger sieht zwar durchaus die Rhetorisierung, der das biographische Material unterworfen wird, doch sein Beitrag läßt ahnen, daß noch die rigide Stropheneinteilung der Sprechoper, also die kleine poetische Maschine, die sich der Autor zurechtgelegt hat, mimetischer Reflex einer biographisch bestimmten Situation ist. Ernst Jandl ist erkenntlich, Friederike Mayröcker ist erkenntlich: „Auch die als ’sie‘ bezeichnete Figur des Stückes, eine ‚Schriftstellerin, ca. 50 Jahre, ca. 173 cm. groß‘, die in dieser Wohnung am frühen Abend ein und am späten wieder aus geht, hat eine Entsprechung im wirklichen Leben, an der sich nicht viel deuteln läßt…“ Ohne den Gestus der Selbstentblößung würde die Rhetorik des Stücks nicht funktionieren.
Jandl, der späte Jandl, ist „jenseits“, schreibt Daniela Striegl: jenseits von Realismus und Avantgarde, aber auch jenseits von Gut und Böse. Das heißt aber, daß er es sich fallweise erlauben kann, böse zu sein. Im Vergleich dazu ist Yoko Tawada selbst dort noch nett, wo sie die Böse spielt, etwa beim Brechen und Durchbrechen der Regeln der Grammatik. Den kindlich-anarchischen Gestus haben Tawada und Jandl (der späte) gemeinsam, nur daß die desillusionierte Unbekümmertheit des „Jenseitigen“ einige Bitterkeit ausdrückt, während aus Tawadas Essays – auch aus Sprachpolizei und Spielpolyglotte in diesem Band – eine Art von bedenkenlosem Optimismus sprüht, der eher an die phonetischen und visuellen Basteleien des frühen Jandl erinnert. „Dichter sind Alchemisten“, schreibt Tawada hier. „Das Wort ‚Kot‘ fängt dann an, nach Hundekot zu duften und das Wort ‚Mist‘ nach einem Misthaufen.“ Diese Definition trifft die Praxis der konkreten Mimesis – des Zum-Ding-Werdens der sprachlichen Zeichen – recht genau. Allerdings beschönigt oder belustigt solches Dichten die unschönen, unlustigen Dinge, wenn es an deren Stelle tritt, um seine eigene Kunstfertigkeit zu entfalten, während in Jandls Spätwerk die Dinge gerade in ihrer Trostlosigkeit avisiert und stehengelassen werden. Über Ottos kotzenden Mops konnten wir noch lachen; nicht mehr über dieses einwandfrei grausliche Kot-Gedicht aus Jandls Bearbeitung der Mütze (in Michael Hammerschmids Beitrag zitiert):
wo gehen ich
liegen spucken
wursten von hunden
saufenkotz
ich denken müssen
in mund nehmen
aufschlecken schlucken
denken müssen nicht wollen
Von ihrer Freiheit Gebrauch machend, kommen die Dichter oft zu ergiebigeren Erkenntnissen als die Literaturwissenschaftler, die sich von ihren Denkschemata ungern entfernen. Aufschlußreich ist die Zuordnung Jandls zum „Elementarismus, die der kubanische Lyriker und Übersetzer Francisco Díaz Solar vornimmt. Der von ihm geprägte Begriff hat erstens den Vorteil, daß er sprachliche, biographische und existentielle Aspekte konjugiert, und er gestattet es zweitens, Jandls Werk mit diversen Autoren und Strömungen anderer Literaturen in Verbindung zu bringen. Denn so wichtig die lokalen Kontexte – Wiener Gruppe, Wiederentdeckung der abgerissenen Tradition der deutschsprachigen Avantgarden, konkrete Poesie – für Jandls Entwicklung gewesen sein mögen, so sehr ist er doch ein internationaler Dichter, wie die Möglichkeit, um nicht zu sagen: die Notwendigkeit, seine Gedichte in andere Sprachen zu übersetzen, beweist. Díaz Solar, Michael Hamburger und Luigi Reitani geben gelungene Beispiele aus ihrer Jandl-Übersetzerwerkstatt. Alle drei scheuen nicht vor dem Verdikt der Unübersetzbarkeit zurück, und alle drei sind überzeugt, daß sich das meiste von Jandl übersetzen läßt. Dabei ist es nicht nur sympathisch, daß Reitani auf dem „sekundären Status“ seiner – und aller – Übersetzungen besteht. Der übersetzte Text bleibt auf das Original angewiesen. Reitani fügt (mit verräterischen Anführungszeichen) hinzu: „Aber braucht nicht jedes ‚Original‘ seine Übersetzung, so wie die Übersetzung das ‚Original‘ braucht?“ Und Michael Hamburger leitet seine Übersetzung von wien: heldenplatz mit dem ebenso paradoxen wie frohgemuten Satz ein: „This poem belongs to the untranslatable sort, but my imitation or travesty goes like this…“