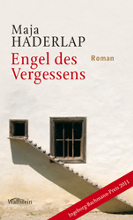Nicht umsonst fürchtet das Mädchen nach einer Jagd, zu der es vom Vater mitgenommen und die mit Kriegserinnerungen und einer Menge Alkohol beschlossen wird, dass sich der Tod in ihr eingenistet habe “wie ein kleiner schwarzer Knopf” (S. 91). Ein sehr schwerwiegender Satz aus dem Mund eines kaum zehnjährigen Mädchens, der in der Jury des Bachmann-Preises nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß, der jedoch ganz bewusst den Beginn einer Entwicklung markiert, die auf den Spuren von Tod und Verstörung stattfindet.
Die Großmutter der Erzählerin war im KZ Ravensbrück, der Großvater und später auch seine Söhne im Wald bei den Partisanen – Zdravko, der Vater, ist kaum zwölf Jahre alt, als er von Polizisten gefoltert wird und sich wie viele Männer der Umgebung in den Wäldern versteckt. Zahlreiche Nachbarn und Verwandte sterben dort im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht, andere werden auf ihren Höfen erschossen oder verschwinden im Gefängnis.
Auf Schritt und Tritt begegnet das Mädchen, das in den 60er Jahren in diesem Kärtner “Graben” aufwächst, dem Tod, nachdem die Großmutter beschlossen hat, die Erziehung ihrer Enkelin zu übernehmen und sie zur Zeugin zu machen – gegen den Willen der Mutter, die dem Kind ganz andere Geschichten und Lieder mit auf den Weg geben will. Auch bei diesem kleinen Krieg innerhalb der Familie geht es also um den großen Krieg, der in den Köpfen der Überlebenden weiter tobt und das Zusammensein tageweise zur Hölle macht.
Vater rennt im Traum immer noch um sein Leben, und bei Familienfesten, wenn in der Wohnstube erzählt wird, verliert er leicht die Fassung, spielt in einem Augenblick noch mit der Harmonika zum Tanz auf, um im nächsten zu einem anderen, bedrohlichen Wesen zu werden: “Sobald der letzte Gast gegangen ist, nimmt der Augengeist von Vater Besitz und tanzt mit ihm eine entfesselte Polka, schleudert ihn in alle möglichen Richtungen. Die Linkspolka wirft Vater in eine tiefe Niedergeschlagenheit, die Rechtspolka in einen wilden Zorn, der sich mit durchdringenden Schreien entlädt und sich an kleinen Missverständnissen entzündet. Mein Bruder und ich werden aus der Stube gewiesen und wissen vor Beklemmung nicht, was tun. Wir stehen in der Küche herum oder laufen ins Freie. Wir sind überzeugt, dass der Krieg für ein paar Tage in unser Haus gezogen ist und nicht bereit ist zu weichen.” (S. 95) An anderen Tagen rennen die Kinder den Hang hinauf in den Wald, weil der Vater laut schreiend mit einem Jagdgewehr in der Hand droht, sie zu erschießen. (S. 96)
Bei aller Bedrohung ist und bleibt das erzählende Mädchen ein Vaterkind, eine Komplizin, und natürlich fühlt sie sich berufen, ihn zu retten. Dabei gibt es auch reichlich skurrile Szenen, etwa eine Traktorfahrt von Eisenkappel nach Lepena in einer eiskalten Winternacht, in der die inzwischen erwachsene Tochter erst den Hitlergruß und dann Partisanenlieder schmettert, um ihren betrunkenen Vater, der sich in den Schnee gelegt hat, zum Mitfahren zu bewegen (S. 184).
Viele Ereignisse könnten sich in einer beliebigen Zeit in einem beliebigen Dorf zutragen, wo Alkohol, Waffenbesitz und soziale Isolation unheilvoll zusammenwirken und die Kinder abends ins Wirtshaus geschickt werden, um den Vater heimzuholen, der ‚vergessen‘ hat nach Hause zu kommen. Und doch gelingt es der Erzählerin, die Würde ihrer Figuren zu bewahren, dieser eine Vater und diese eine Großmutter sind tatsächliche Helden und sie bleiben es bis zum Schluss – auch für den Leser.
Am Ende des Romans kehrt die erwachsene Erzählerin nochmals zur längst verstorbenen Großmutter zurück, sie besucht das Konzentrationslager Ravensbrück, um Abschied zu nehmen von jenem Ort, “der in Großmutter wirkte, in dessen Magnetfeld sie lebte, an dem sie sich orientierte, der sie bestimmte und ihre Empfindungen an sich zog” (S. 286).
Die erhoffte Erleichterung stellt sich jedoch nicht ein, kein Aufatmen, kein Trost. Die Erzählerin, die als Kind stets gezweifelt hat, ob die Engelbildchen ihrer Mutter sie beschützen können, so naiv wie sie aussehen, spürt hier den kalten Flügelschlag des “Engels der Geschichte”. Und sehnt sich gleichzeitig nach dem titelgebenden “Engel des Vergessens”, der die Spuren der Vergangenheit aus ihrem Gedächtnis tilgen soll. “Er wird eine Erzählung sein”, schreibt sie am Ende (S. 286).
Dies sind aber “nur” die familiären Eckpunkte des Romans, der tief hinein in die jüngere Kärntner Geschichte führt und die Leser mit den Wurzeln eines Konfliktes vertraut macht, in dem anscheinend 66 Jahre nach Kriegsende “immer noch Sturm” herrscht. Exakt in der Woche der Bachmann-Preisverleihung wurde nach jahrzehntelangem Streit das so genannte Ortstafelgesetz im österreichischen Parlament beschlossen. Die öffentliche Debatte dazu hat der Aktualität von Maja Haderlaps Roman zweifellos Nachdruck verliehen. Ebenso wie Peter Handkes bei den Salzburger Festspielen uraufgeführtes Drama “Immer noch Sturm”, in dem der Kärntner Autor literarisch ebenfalls ‘in sein Dorf zurückkehrt’ und seine eigene, teils reale, teils fiktionale Familiengeschichte mit dem Freiheitskampf der Kärntner Slowenen verknüpft, dem einzigen bewaffneten Widerstand gegen das Nazi-Regime innerhalb dessen ursprünglicher Grenzen. Tatsächlich galt dieser Widerstand lange als Heimatverrat, tatsächlich tut sich hier ein “Niemandsland zwischen der behaupteten und der tatsächlichen Geschichte Österreichs” auf (S. 185) und die politische Leistung solcher Texte besteht natürlich darin, diese Familiengeschichten, die sich in Verlassenheit und Isolation vollziehen, in das kollektive Bewusstsein einzufügen.
Maja Haderlaps Portrait ihrer Familie und Heimat ist jedoch keineswegs nur ein politisches, sondern auch ein sehr sinnliches Buch. In kräftigen poetischen Bildern skizziert die Autorin ihre Kindheit in einer traditionellen slowenischen Dorfkultur, gleich zu Beginn etwa die Speisen der Großmutter, die alle nach “schwarzer Küche” schmecken: “Der Speck und das Heidenmehl, das Schmalz und die Marmelade, sogar die Eier riechen nach Erde, Rauch und gesäuerter Luft.” (S. 5)
Ein andermal steht das Kind “in einem Dunstschleier aus Behaglichkeit” im Kuhstall, die Mutter ist beim Melken und die Hände der Tochter riechen nach Schweinen, auf ihren Wangen kleben milchfeuchte Katzenhaare. (S. 17f)
Nicht zu vergessen die zahlreichen Wald-Beschreibungen, vom kleinen Wald hinter dem Haus über den Holzschlag des Vaters bis zu den Jagdritualen und den großen Wäldern, die zu einem Mythos geworden sind: “In den Wald zu gehen bedeutet in unserer Sprache nicht nur, Bäume zu fällen, zu jagen oder Pilze zu sammeln. Es heißt auch, wie immer erzählt wird, sich zu verstecken, zu flüchten, aus dem Hinterhalt anzugreifen.” (S. 75)
Fast unglaublich und zugleich sehr verständlich ist schließlich der Weg, den die Erzählerin/Autorin später einschlägt, vom slowenischen Gymnasium in Klagenfurt, wo sie bereits Gedichte schreibt, ans Wiener Institut für Theaterwissenschaft, und viel später wieder zurück nach Klagenfurt – als Universitätslektorin und langjährige Chefdramaturgin des Stadttheaters. Ins Gymnasium schickt sie die Mutter, die irgendwann die Organisation der Familie übernimmt und sich hier gegen den Vater durchsetzt, später darf die kluge Tochter “tun, was sie will, solange sie keine Schande bringt” (S. 174).
Das Theater will die Partisanentochter per Eigendefinition zum Raum machen, wo sie “allen Verzweiflungen und Verstrickungen gefahrlos begegnen kann“ (S. 174). Dieser geschützte künstlerische Zugang zur eigenen Geschichte war offenbar nur ein zaghafter Anfang, denn nun ist die Autorin ganz bei sich angekommen und stellt sich völlig unmaskiert ihrem Lebensthema.
Der Trapezakt, das Persönliche zum Politischen und beides gleichzeitig zu Literatur zu machen, ist dabei weitgehend gelungen, auch wenn die Gefahr “in unliterarische politische Korrektheit zu kippen, bei diesem Thema so hoch wie die Karawanken” ist (Harald Klauhs in der “Presse” vom 10. Juli 2011) und die scheinbar naive Kindperspektive nur in den ersten Kapiteln des Romans funktionieren kann. Mit zunehmendem Alter der Erzählerin müssen auch Reflexionen, politische Exkurse, Träume und immerhin drei Zeitebenen im Text Platz finden. Die Reisen der Erzählerin zwischen Wien und Lepena werden zu “Zeitexpeditionen”, zu Fahrten durch unterschiedliche Zeitläufte und Geschichtsvarianten, die nebeneinander existieren (S. 185), hier verliert auch die Sprache ihre anfängliche Homogenität.
Überzeugend und tief berührend ist der Roman dort, wo die Autorin nah an den beschriebenen Personen und ihren Erlebnissen bleibt und schlicht erzählt – dabei zaubert die versierte Lyrikerin einen Klangteppich herbei, der wie im Flug durch das dichte Netz an Geschichten trägt.