Den Auftakt machen zwei Beiträge zu Gavrilo Princip, dem Attentäter von Sarajewo, auch als Beispiel dafür, welche Folgen noch im Abstand von 100 Jahren Neulektüren von historischen Fakten, die früher etwas strenger mit dem Begriff „Revision“ gefasst wurden, zeitigen können. Neben Beiträgen zu Georg Trakl oder Theodor Kramer als Beispiele für Kriegslyrik der anderen Art, widmen sich mehrere Aufsätze dem Genre Tagebuch und anderen Formen der Erinnerungsprosa. Ludwig Birós Roman „Das Haus Molitor“ wird ebenso vorgestellt wie Iván Sándors Roman „Husar in der Hölle – 1914“. Für den deutschsprachigen Roman steht Joseph Roths „Radetzkymarsch“ – auf vergessene deutschsprachige Antikriegsromane etwa von Rudolf Geist oder Marie Eugenie delle Grazie musste wohl aus Platzgründen verzichtet werden. Dass mitunter grammatische Probleme – „Beider Lektüre von Kafkas Tagebüchern 1914-1923 erfährt man direkt nur wenige über den Krieg oder man erfährt eher vieles über den inneren Kriegs des Subjekts“ (S. 105) – die Lektüre etwas erschweren, hat vielleicht mit der beeindruckenden Geschwindigkeit zu tun, mit der dieser Tagungsband vorgelegt wurde.
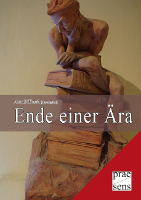
Ende einer Ära
// Rezension von Redaktion
Auch im Rahmen der Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg im Gedenkjahr 2014 wiederholten „sich Machtverhältnisse und asymmetrische Beziehungen zwischen den verschiedenen Regionen der Welt“ (S. 97), heißt es im Beitrag von Jean Bertrand-Miguoué, der ausgehend von Kafkas Tagebüchern 1914-1923 über „Selbst- und Weltreflexionen“ nachdenkt und auch die Perspektive afrikanischer Länder auf den Großen Krieg reflektiert. Diesen prinzipiellen Ungleichgewichten bzw. Schräglagen der Erinnerungskultur entgegenzuarbeiten, war das Ziel der dritten Tagung im Rahmen des Franz Werfel-Stipendienprogramms des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Ehemalige StipendiatInnen setzten sich hier mit dem Thema Erster Weltkrieg auseinander, und dabei ging es um die jeweils unterschiedlichen Blickrichtungen und Forschungstraditionen in den verschiedenen Ländern genauso wie um vergessene oder im deutschsprachigen Kulturraum kaum bekannte Autoren bzw. Werke.
Arnulf Knafl (Hg.) Ende einer Ära
1914 in den Literaturen der Donaumonarchie und ihrer Nachfolgestaaten.
Beiträge zur Jahrestagung der Franz Werfel-StipendiatInnen am 28./29. März 2014 in Wien.
Wien: Praesens, 2014.
186 S.; geb.
ISBN 978-3-7069-0829-0.
Rezension vom 04.11.2015
Originalbeitrag. Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser:innen verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.