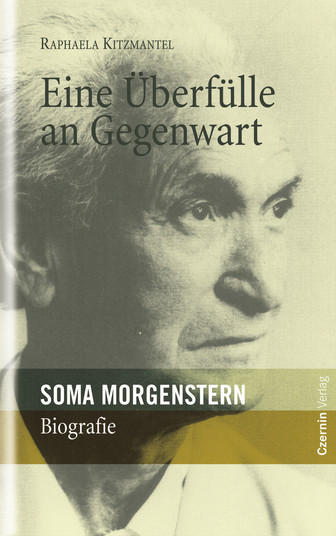Obwohl das zu Lebzeiten erschienene Werk Morgensterns, insbesondere die Romantrilogie „Funken im Abgrund“ höchstes Lob aus berufenem Mund der Zeitgenossen (zum Beispiel Robert Musils) erhielt, wurde es nach 1945 bald sehr still um ihn. Teile seines Werks, das er zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in der französischen Emigration geschrieben hatte, gingen auf der Flucht verloren und mussten von ihm in Amerika wieder rekonstruiert werden. Sie wurden zu seinen Lebzeiten nicht mehr publiziert. Dabei sind Morgensterns Erinnerungen an seine Freunde Joseph Roth („Joseph Roths Flucht und Ende“) und Alban Berg („Alban Berg und seine Idole“) lesenswerte, in biographischen Details nicht immer zuverlässige, auf die anekdotische Pointe gearbeitete Werke der Memoirenliteratur. Leider umfasst die Werkausgabe nur zum Teil die Briefe Morgensterns. Umso nachdrücklicher sei die Lektüre des Briefwechsels mit Alban Berg empfohlen, der eindrücklich das intellektuelle Milieu der späten 20er und frühen 30er Jahre in Wien beschreibt, in dem sich etwa der junge Adorno staunend und oft ratlos zu orientieren suchte.
Raphaela Kitzmantel hat über diesen wieder entdeckten Autor eine einfache, gut lesbare Biografie geschrieben, die im dokumentarischen Material Ingolf Schultes Pionierleistung nicht übertreffen kann und dies auch gar nicht erst versucht. Dieser Biografie ist eine längere akademische (und auch publizistische) Beschäftigung der Autorin mit Soma Morgenstern vorausgegangen; in bibliographischer Hinsicht wäre eine Aktualisierung wünschenswert gewesen (so wird etwa der letzte Band der Werkausgabe nicht ausgewiesen, sondern die darin enthaltenen Texte werden in den schwer erreichbaren Erstdrucken oder aus dem Nachlass zitiert).
Was diese Biografie rechtfertigt und was sie zu ihren Gunsten vorbringen kann, sind also nicht etwa neu aufgefundene Quellen, eine spezielle Reflektiertheit des Genres Biografie oder komplexe Lektüren der Werke, sondern die Versuche, das im Rahmen der Werkausgabe erarbeitete Dokumentarische um das mit Auge und Ohr noch aufnehmbare Lebendige zu bereichern: Es gibt in diesem Buch die Spuren einer Reise der Autorin in die ostjüdische Herkunftswelt Morgensterns. Dies führt zu anschaulichen und berührenden Skizzen der Handlungsschauplätze der Texte wie der frühen Jahre dieses Autors, der seine Herkunftswelt nach dem Studium in Wien und dem Militärdienst des Ersten Weltkriegs (in Serbien und Ungarn) 1921 ein letztes Mal gesehen hat. Wichtig sind die Hinweise zu Morgensterns politisch-religiöser Position: Er hat den Zionismus eben so abgelehnt wie die zunehmend als scheiternd wahrgenommene Position der jüdischen Assimilation; ja er hat, darin seinem Freund Joseph Roth ähnlich, den Zionismus als Assimilation an den westeuropäischen Nationalismus aufgefasst.
Es gibt in Kitzmantels Biografie aber auch die Spuren von Morgensterns Sohn Dan – 1929 als Österreicher in München geboren und heute Direktor des Institute of Jazz Studies an der Rutgers University – und von anderen noch bzw. jetzt auch schon nicht mehr lebenden Freunden und Bekannten. In den im Anhang mitgeteilten Interview-Ausschnitten erzählen sie durchaus polyphon und dissonant von diesem Mann, der das Erzählen, die Frauen und den in jeder Hinsicht inkorrekten Witz geliebt haben muss.
Al Hirschfeld (1903 – 2003), Karikaturist der New York Times, beginnt seine Erinnerung an Morgenstern beispielsweise mit dieser Anekdote: „Kurz nach seiner Ankunft in New York war Morgenstern bei uns zum Essen. Jemand fragte ihn, ob er diese Show – ich weiss nicht mehr genau, welche – gesehen hat. Morgenstern antwortete: ‚Nein, zum Glück war ich in einem Konzentrationslager zu dieser Zeit.‘ Das ist schwarzer Humor. Sehr typisch für ihn.“ Morgensterns Sohn erinnert erbittert an die witzlose Provinzialität Wiens in der Nachkriegszeit: „Anfang der Fünfzigerjahre fuhr er auch nach Wien. […] Er fand, Wien hatte sich in eine provinzielle Stadt verwandelt, das intellektuelle Leben war verschwunden. Er kam noch einmal zurück, vor allem um seinen Freund Klemperer zu treffen, der in Wien und London dirigierte. Aber das war das letzte Mal.“
Am schlechtesten kommt Morgenstern bei Marietta Torberg weg, die ihn allerdings auch nur „oberflächlich gekannt“ hat und ihn „als Typ“ nicht mochte: „Er war ein nicht sehr appetitlicher, mürrischer Mensch, nicht humorlos, aber sein Humor war böse. Mein Haupteindruck war: Das ist ein bösartiger Mensch.“
Nora Koster, die nach den Worten einer anderen Zeugin Morgenstern sehr geliebt hat, der in New York nicht mehr mit seiner Ehefrau Ingeborg von Klenau – Tochter des dänischen Komponisten Paul von Klenau – lebte, spricht hingegen mit grösster Dezenz von ihm als „stille Person“, mit dem es schwer gewesen sei, „über persönliche Dinge“ zu reden. In diesen subjektiven Brechungen kommen wir zwar nicht der (unerreichbaren) biographischen Wahrheit näher, aber diese Brechungen verraten etwas von der Strahlkraft dieser Person, von der schon Zeitgenossen wie Adorno oder Benjamin eben so angezogen wie mitunter auch irritiert waren. Es ist das Verdienst dieser Biografie, das Spektrum der Erzählungen der Zeitgenossen und Bekannten erweitert zu haben. Die Faszination der Verfasserin für den Autor bleibt immer spürbar; die analytische Durchdringung des literarischen Werks oder der Lebensdokumente gehört nicht zu den Zielen dieses Buches, das eine übersichtliche Einführung zu einem beachtlichen Werk bietet und hoffentlich nicht vergebens darum wirbt, dieses Werk auch zu lesen.