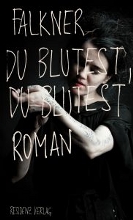Wenn Michaela Falkners neues Buch vom Verlag also als „Roman“ angekündigt wird, wird man ein wenig hellhörig – ein Roman, eine Erzählung also, stringent und auf lange Strecke angelegt, das passt so gar nicht zu ihrem bisherigen Schaffen. Und tatsächlich ist das, wovon am Buchdeckel die Rede ist, auch ohne Schwierigkeiten im Text erkennbar: Da zettelt ein Kind, „unschuldiger Anarchist wie alle Kinder“, eine Revolution gegen die Welt der Erwachsenen an. Diese ist, soviel sich herauslesen lässt, in Krieg versunken, klare Fronten sieht man keine, dafür willkürliche Folter und Mord überall. Die mediale Inszenierung der Grausamkeiten wird dabei von in Konfettigewittern jubelnden Massen beobachtet.
Während sich die Erwachsenen in Falkners Fiebertraum gegenseitig bis aufs Blut peinigen und jeder wild um sich schlägt, kratzt und beißt, ist man sich scheinbar nur in einer Hinsicht einig: dem Einschlagen auf die Schwächsten, die Kinder. Ivan, ein Zwölfjähriger, der wie alle seines Alters Spuren schwerster Misshandlung trägt, wird zum Anführer einer Bande. Um aber die Schar seiner Jünger zuzurichten, vorzubereiten, wendet er bald die Methoden an, die einst auf ihn angewandt worden waren.
Dass man im Krisenfall leicht einmal auf die Mittel der Gegner zurückgreift, weil man eben einfach nichts anderes kennt, dass man früher oder später also zu den Bösen gehört, wenn man sich nicht radikal abwendet – das ist nicht unbedingt eine neue, tiefe Einsicht. Die Komplexität des Buches, so gelesen, erschöpft sich rein quantitativ, in der unüberschaubaren Zahl von geschilderten Gräueltaten beispielsweise. (Nicht unpassend ist die Sprechinstanz auch von einem manischen Zählzwang besessen.)
Aber darum geht es Falkner wohl nicht. Dass man nämlich den Plot genau so stehen lassen soll, wie es am Buchdeckel empfohlen wird, ist erstens zu bezweifeln. Das hergebrachte Handwerkszeug der Erzählkunst hat Falkner nie angerührt. Eine bildträchtige Gleichzeitigkeit durchzieht stattdessen den Roman, in dem die Idylle („Ich wünschte nur, die Menschen hier wären so glücklich wie ich es war.“) nicht chronologisch, sondern bloß logisch der Apokalypse vorausgeht.
Und damit kommt zweitens wieder die Freiheit des Lesers ins Spiel, zumindest in Form der Deutungshoheit: An Stelle der apokalyptischen Schlacht, der universalen, aber leerlaufenden Dystopie, bietet sich ein symbolisches Seelentheater an, wenn man so will, eine Geschichte über die Auflehnung gegen die sich zuspitzenden Anfeindungen der Außenwelt, ob diese nun gesellschaftlicher, medialer oder tatsächlich physischer Art sind.
Den Sprachfluss, obwohl im Gegensatz zu ihrem bisherigen Werk stark zurückgenommen, bestimmen auch hier vor allem Elemente der Dissoziation, der Redundanz, eine stark fragmentierte Syntax, die Auflösung der Chronologie, Sprechchöre ohne Sprecher und dergleichen. Dieser Duktus, der den Leser dem Text nicht gespannt folgen lässt, sondern ihn im geglückten Fall in seinen Bann schlägt, erhält vor allem dann seine Dichte, wenn man ihn im Tonfall einer Ansprache, einer Verkündigung liest. (Die Textsorte des Manifests bildet ja auch Falkners jüngstes Arbeitsgebiet.)
„ich mache keine Fehler, aber ich übergebe mich dauernd“, äußert der Protagonist anfangs. Falkners Prosa ist (vergleichbar ihren Performances) eine stark somatische, in ihrer Konzeption wie ihrer Wirkung. Kein Geruch, keine wirklichen optischen Reize, bruchstückhafte Handlung – die Hauptrolle spielt der fiktionale Körper, der eigene wie der fremde. Dessen zahllose Verletzungen haben genauso peinigenden wie rituellen, austreibenden Charakter; Traditionen des Aktionismus werden hier mit sprachlichen Mitteln fortgesetzt: „Aufgeschnitten und wieder zugenäht, dann stürzt erneut Blut heraus, gereinigt, getötet und zerteilt.“
Falkners Text lässt den Eingriff in die Körperlichkeit als einzige Option erscheinen; es ist die Prosa einer stilisierten Verängstigung, die sich um den Leser nicht so sehr kümmert, ihn vielmehr attackiert – ein Angriff als Verteidigung.