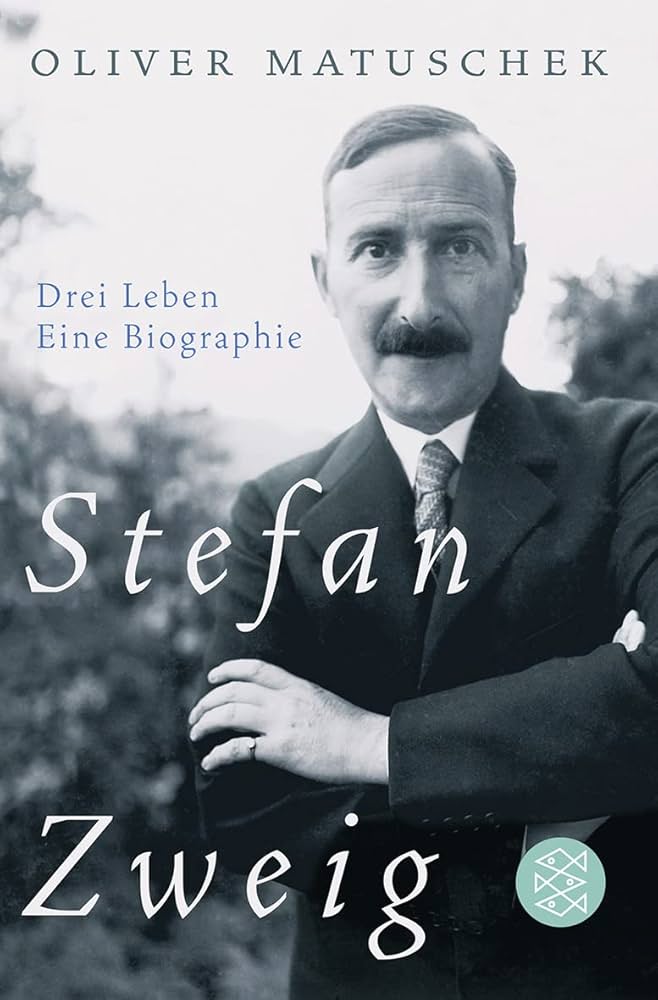Gründe dafür gibt es einige: Das Jahr 2006 ist neben all den anderen Jubiläen auch ein Stefan Zweig-Jahr (125. Geburtstag) und seit Donald Praters Biographie über Zweig aus dem Jahr 1981 wurde keine umfassende Darstellung der gesamten Lebensspanne mehr veröffentlicht. Dem Autor Oliver Matuschek ist es nun gelungen, bisher unbekannte Quellen und Dokumente ausfindig zu machen, die eine neuerliche Zusammenfassung altbekannter Details, ergänzt durch die Erkenntnisse der Zweig-Forschung der letzten Jahre durchaus rechtfertigen. Die bisher nicht ausgewerteten Materialien, auf die Matuschek zurückgreifen kann – allen voran rund 200 unpublizierte Briefe des Bruders Alfred, Briefe von Zweigs zweiter Ehefrau Lotte, diverse Aussagen der ersten Ehefrau Friderike Zweig -, werfen vor allem ein neues Licht auf den Privatmenschen Zweig.
Im Gegensatz zu den teilweise geschickt manipulierten, die Tatsachen aus Eigeninteresse verschleiernden Erinnerungsbüchern Friderike Zweigs sowie anderen biographischen Darstellungen verzichtet Matuschek konsequent auf jegliche Spekulationen und verdichtet das ihm vorliegende, akribisch zusammengetragene Material zu einer spannenden Lebensdarstellung. Er folgt Zweigs Lebensweg voll Sympathie und dennoch völlig unsentimental. Zweig und seine Drei Leben – so auch der geplante Titel der Autobiographie, die dann als „Welt von gestern“ erscheinen sollte – sind für Matuschek nicht nur titelgebend, sondern bilden auch die Grobeinteilung des Buches: Zweigs Kindheit und Jugend in Wien, seine ersten schriftstellerischen Versuche und Erfolge bis hin zum Ersten Weltkrieg bilden den ersten Teil. Teil zwei beinhaltet die Übersiedlung nach Salzburg, die Heirat mit Friderike von Winternitz sowie den Aufstieg zum international gefeierten Schriftsteller und endet mit dem Gang ins Exil im Jahr 1934. Hier setzt auch das „dritte Leben“ an, das mit Zweigs Selbstmord im brasilianischen Petrópolis 1942 sein Ende findet.
Detailreich porträtiert Matuschek einmal mehr Zweig als Pazifisten, Humanisten und überzeugten Europäer vor dem Hintergrund der zeithistorischen Ereignisse, dokumentiert den Vielschreiber, passionierten Reisenden, den ständig von seiner inneren Unruhe Getriebenen. Er analysiert unspekulativ, ausschließlich unter Heranziehung der vorliegenden Quellen die Verquickung von Zweigs Werk – als Wendepunkte z. B. „Jeremias“ (1917) oder „Erasmus“ (1934) – mit der jeweiligen aktuellen biographischen Situation, beschreibt ausführlich Zweigs Verhältnis zu Freunden, Schriftstellerkollegen, zu den wichtigen Frauen seines Lebens und bietet so auch dem Zweig-Kenner eine spannende, auf das Wesentliche verdichtete Lektüre.
Besonders verdienstvoll ist auch Matuscheks vielfacher Verweis auf den Autographensammler Stefan Zweig, der mit seiner legendären Sammlung von Schriftsteller- und Musikerhandschriften ein eigenes Kunstwerk schuf, das er selbst immer auch als wichtigen Bestandteil seines Schaffens verstanden haben wollte, das jedoch von der Forschung bisher häufig als interessante „Nebensache“ behandelt wurde. Hier gebührt ebenfalls Matuschek das Verdienst, erst im Vorjahr eine lange bestehende Lücke erfolgreich geschlossen zu haben („Ich kenne den Zauber der Schrift. Katalog und Geschichte der Autographensammlung Stefan Zweig“. Wien: Inlibris 2005).