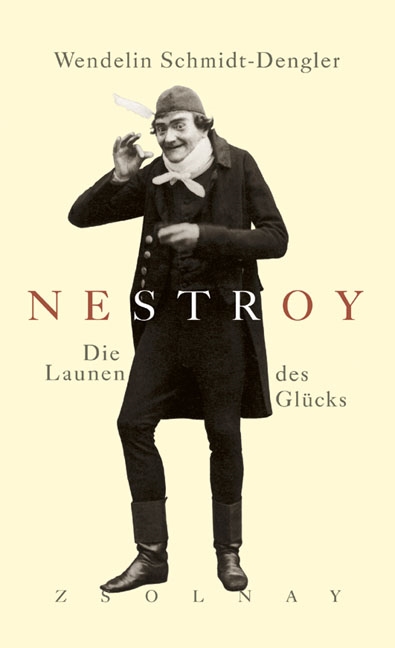Nachweisbar an der „legendären“ Rivalität zwischen Raimund und Nestroy ist lediglich, daß Raimund an Nestroys forciertem Spiel Anstoß nahm. In einem Brief vom 2. Mai 1832 schlug er dem befreundeten Schauspieler Karl Ludolph, der ihn um die Überlassung der „Gefesselten Phantasie“ für sein Benefiz am Theater an der Wien ersucht hatte, diese Bitte aus Mißtrauen gegen den „doch ein wenig auf die Spitze gestellten Spekulationsgeist“ des Theaterdirektors Karl Carl ab und fügte den Satz hinzu: „Dann – habe ich allen Respekt vor HE Nestroi, wenn er auch gar keinen vor mir hat, aber wenn meine Stücke, so lange sie noch ungedruckt sind, an der Wien aufgeführt werden, so wünsche ich, daß die Hauptrolle (Nachtigall) in meinem Geiste gegeben wird, wodurch die Stücke allein in ihrer wahren Gestalt erscheinen.“
Otto Rommel, der Doyen der österreichischen Nestroy-Forschung, mutmaßt in seiner Geschichte der „Alt-Wiener Volkskomödie“ (1952), daß Raimund, der Nestroy nie in einer tragenden Rolle eines seiner Stücke gesehen haben kann, seine Abneigung auf einen Bericht des Grazer Korrespondenten von Adolf Bäuerles „Theaterzeitung“ (1829, Nummer 37) gegründet habe. Der habe über eine Aufführung von Raimunds „Alpenkönig und Menschenfeind“ am Ständischen Theater in Graz befunden, Nestroys Rappelkopf habe „eher den Eindruck eines Menschenfressers als den eines Menschenfeindes“ gemacht und trägt mit diesem G’schichterl zur Legendenbildung bei; ein G’schichterl, das, was die Illustration der darstellerischen Outrage und des Gegensatzes zwischen dem „gemütvollen“ Raimund und dem „zynischen“ Nestroy betrifft, zu schön ist – zu schön, um wahr zu sein – und das sich noch in Herbert Zemans kürzlich erschienenem Nestroy-Buch wiederfindet.
Der Korrespondentenbericht „Aus Grätz“ der „Allgemeinen Theaterzeitung“ hatte zwar an der von Raimund überzeichneten Figur des Rappelkopf einiges auszusetzen – „dieser Menschenhasser, welcher weit eher ein Menschenfresser genannt werden dürfte“ -, nicht jedoch an Nestroys Interpretation: „Hr. Nestroy (Rappelkopf) [war] zwar durchaus brav zu nennen, nur hätten wir gewünscht, daß er in seiner Sprache etwas den Wiener Dialekt hätte vorschlagen lassen.“
Otto Rommel hält allerdings auch dezidiert fest: „Prüft man unvoreingenommen die Zeugnisse, so erkennt man, daß die Übersteigerung des Gegensatzes Raimund-Nestroy in den Jahren 1834-1836 ein reines Literatengeschwätz ist.“
Eine der schönsten Blüten treibt das Gegeneinanderausspielen dieser in ihrem schematischen Antagonismus scheinbar siamesisch verwachsenen Zwillinge bei Josef Nadler: Der postuliert 1928 in seiner „Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften“ steif und fest: „Keiner von ihnen vermag das Ganze zu bedeuten. Sie sind ein Ring, der erst geschlossen ganz und vollkommen sind“ – und versteigt sich dazu, den „Lumpacivagabundus“ aus dem Jahr 1833 als Parodie des „Verschwenders“ aus dem Jahr 1834 auszuweisen.
Mögen schematische Vergleiche à la Raimund-Nestroy wenn schon nicht sicher, so vielleicht sicherer machen, so sollte über ihnen doch nicht die differenzierte Analyse des je Unvergleichlichen zu kurz kommen. Selbst Nestroys hartnäckigster publizistischer Widersacher, der Kritiker Moritz Gottlieb Saphir, attestierte dem von ihm Vielgeschmähten 1839 eine Einmaligkeit und Unvergleichlichkeit, die zu beherzigen offenbar nach wie vor Desiderat ist: „Unter den meisten jetzigen Erzeugern der Volksbühnen-Produkte steht Nestroy da, wie ein Maibaum zwischen Hopfenstangen. Nestroy ist weder Volksdichter, noch Lokalpossendichter, er ist eine eigene Gattung, er hat sich diese Gattung selbst geschaffen, er ist der einzige Primo Buffo assoluto der drastischen Volksnatur-Dichter.“
Es will daher nicht recht einleuchten, warum Renate Wagners Nestroy-Kompendium die ausführliche Chronik als Paarlauf – beziehungsweise, mit Grillparzer als drittem im Bunde, als Pas de trois – inszeniert, in dem unvermittelt Raimunds Lebensdaten neben denen Nestroys figurieren. Biographie über eine durch Querverweise mit einem „Lexikon“-Teil verknüpfte und durch ein konzis kommentiertes Stückeverzeichnis aufgefettete Auflistung von Daten und Fakten zu bewerkstelligen ist durchaus plausibel – vor allem, wenn man die der trockenen Chronik auf der Emotionenskala gegenüberstehende Spielart des Genres betrachtet: die schmalztriefende spekulative Romanbiographie, der diese Vorgehensweise allemal vorzuziehen ist. Allerdings sind die Einträge im Abschnitt „Menschen und Begriffe“ zu spärlich, als daß damit Fleisch auf die Knochen käme.
„Wertend nicht miteinander verglichen werden sollten“ Herbert Zeman zufolge die verschiedenen „Welt-Anschauungen“: hier Nestroys „satirische Aggressivität“, da die „heitere Gemüthaftigkeit“ Raimunds. Ein hehres Ziel. Wenn Nestroy allerdings die häuslichen Zerwürfnisse, die seine „Ausbrüche in die Niederungen sexueller Befriedigung“ (Zeman), sprich seine Seitensprünge, verursachen, mit dem Grundsatz zu entschuldigen versucht „Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß“ (soll heißen: seine langjährige Lebensgefährtin Marie Weiler hätte ihm eben nicht nachspionieren sollen), kommentiert Zeman moralisierend: „Das ist eine realistische, aber traurige Haltung. Ein sittlich-objektiver Maßstab, den man – kulturgeschichtlich gesprochen – noch von Raimund kannte, wird hier nicht mehr greifbar, und die Redlichkeit des Handelns existiert nicht mehr.“
Ein gedrängter biographischer Abriß steckt das politische, soziale und kulturelle Umfeld, in dem Nestroy sich bewegte, geschickt und präzise ab, zeigt aber andererseits keine Scheu davor, Lücken in der Überlieferung durch genrebildhafte Einsprengsel zu schließen und taxfrei „passende“ Passagen aus den Stücken als autobiographische Erinnerungen des Autors auszuweisen. Was (neben der, gelinde gesagt, possenhaften Orthographie) umso mehr befremdet, als Zeman mit bisher unveröffentlichten Nestroy-Handschriften aus dem Archiv der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde aufwarten kann, die nunmehr belegen, was man bisher bloß vermutet hatte: daß Nestroy bereits mit siebzehn Jahren und in den Jahren 1819 bis 1822 regelmäßig in Konzerten als Chorist und Solist auf der Bühne stand. Am 17. Februar 1819 etwa entschuldigt er sich in einem Brief bei „der Comittée des großen Musickvereins“: Er müsse den „Singpart“ zurückschicken, da er gerade von einer Krankheit genesen sei, aber das Haus noch nicht verlassen dürfe, er werde aber fürs nächste „Gesellschafts=Concerte“ wieder zur Verfügung stehen und in „drey oder vier Wochen“ bei den „Musicken im rothen Apfel wieder zu Diensten“ sein.
Kenntnisreich weist Zemann auf den Stellenwert der Musikeinlagen und Couplets in Nestroys Stücken hin, deren Koloraturen und Tonumfang von den Darstellern der Zentralfiguren nicht lediglich geschulte, sondern voll ausgebildeten Stimme forderten. Kenntnisreich weist Zemann auch Analogien und Verwandtschaften in Figurenkonstellationen und Handlungsführung zum zeitgenössischen Musiktheaterrepertoire nach, das Nestroy als längjähriger Opernsänger ja intus hatte, beläßt es allerdings zumeist positivistisch bei der Feststellung der Filiation, ohne auf die Funktion im Possenzusammenhang einzugehen.
„Skepsis als Welthaltung und pragmatische Lebensdarstellung auf dem Theater bestimmen Nestroys Kunst“ – aus dieser auf Themen und Inhalte, bisweilen auch unverblümt auf die „Botschaft“ von Nestroys Stücken abhebenden Perspektive unternimmt Zeman eine ausführliche chronologische Analyse von Nestroys Theaterschaffen, die nur eben daran krankt, daß sie lediglich am Rande berührt, was Nestroy heute überhaupt noch interessant macht: die Sprachartistik.
Denn selbst wenn man Nestroys Stücke als Kommentare zur österreichischen Sozialgeschichte der Jahre 1830 bis 1860 lesen kann, so besteht deren Leistung doch nicht darin, etwa die sozialen Widersprüche aufgezeigt zu haben, sondern im „künstlerischen Aufdecken der Sprachlichkeit und Spielhaftigkeit des gesellschaftlichen Rollenspiels“, wie Jürgen Hein, Mitherausgeber der neuen historisch-kritischen Nestroy-Ausgabe, in seinem Metzler-Materialienband 1990 gegen naturalistische Deutungsmuster klarlegt.
Das eigentümlich Nestroysche liegt in der Sprache. An Nestroys Werk fasziniert heute nicht das immer gleiche Inventar grob geschnitzter Figuren und die immer gleich ablaufende Possenmechanik mit ihrem Räderwerk aus „Liebe, Intrige, Geld und Dummheit“, diesen immer gleichen Geschichten von Testamentsklauseln, geldgierigen Vormündern, diktierten Verlobungen und Deus-ex-machina-Erbschaften, diesen banalen Verwechslungskomödien mit ihrer allzuoft löwingerbühnenhaften Situationskomik.
Wider den Positivismus, der „frohgemut“ glaubt, mit der Identifikation der Filiationen und der Rekonstruktion von Stammbäumen und der historischen Voraussetzungen den Text auch schon erschlossen zu haben, schlägt sich Wendelin Schmidt-Dengler auf die Seite Karl Kraus‘, der Nestroy Anfang des 20. Jahrhunderts als Satiriker wiederentdeckt hatte, „in dem sich die Sprache Gedanken macht über die Dinge“ – und über sich selbst, wäre zu ergänzen.
Seiner Prämisse folgend, daß Nestroys Werk seine „Haltbarkeit vor allem der Wortkunst“ verdankt und er „in der Schrift“ bei weitem gewichtiger präsent ist als in Bühneninszenierungen, widmet sich Schmidt-Dengler in seiner essayistisch aufgelockerten Abhandlung „Die Launen des Glücks“ denn auch den Partituren: „Beim Lesen ergibt sich eindeutig ein Surplus an Genuß im Vergleich zum Zuschauen.“ Die Dichte der Einfälle, die sprachliche Virtuosität ist nur in der Lektüre auszukosten. Und einem Close reading unterzieht Schmidt-Dengler auch Nestroy-Stücke, die der reduktionistischen Kanonbildung, die eine organische Entwicklung von einer Frühzeit über eine Periode der Meisterschaft bis hin zu einer Verfallsphase postuliert, zum Opfer gefallen sind; ohne Nestroy gleich zum Ahnherrn irgendwelcher sprachskeptischer Avantgarden oder des Theater des Absurden auszurufen; ohne den Possendialogen mehr Tiefsinn abzupressen, als eben drinsteckt, ohne aber auch der Volkskomödie von vornherein Dignität, Tiefgang oder politische Brisanz abzusprechen.
Das gewohnte Animo beflügelt ihn nicht nur auf seinen galligen „Exkursen in die akademische Verhaltensforschung“, sondern, mit dem Rüstzeug des Literaturwissenschaftlers im Gepäck, auch auf seinen bisweilen weiten Umwegen (auch über Raimund) – die allerdings die Ortskenntnis erhöhen, wie Schmidt-Dengler mit Wolfgang Preisendanz seine „Annäherungen“ verstanden wissen will.
Sowenig er Nestroy darauf reduziert, so wenig sieht Schmidt-Dengler doch von der Alt-Wiener Komödientradition und der zeitgenössischen Bühnenpraxis ab. Er leitet im Gegenteil davon das Spezifische Nestroyscher Sprachkunst her: Bei Nestroy geht die Allegorie als Bühnenfigur des Alt-Wiener Volkstheaters im sprachlichen Bild auf. Oder wie Schmidt-Dengler seine Kernthese pointiert formuliert (die Allegorese in Peter Spanns Auftrittsmonolog „Der Holzhacker hat die Geometrie umarmt, und so is der Zimmermann entstanden“ weiterspinnend): „Ein Volksschauspieler hat die Allegorie umarmt, und so ist Nestroy entstanden.“ Ein Volksschauspieler, dessen Bildspekulation und Wortwitz ihre analytische Energie und ihr kritisches Potential ganz ohne betuliche Didaxe oder „magistrale Gestikulation“ enfalten.
In einem Gespräch über den Witz in der Posse „Unverhofft“ behauptet der Maler Arnold, es gehe nichts über den harmlosen Witz, worauf der kritische Herr von Ledig sagt, er meine damit sicher den geistlosen Witz. – Arnold: „Ah, wäre denn harmlos und geistlos dasselbe?“ – Ledig: „Wenigstens kein großer Unterschied, denn nur der geistlose Mensch kann den Harm übersehn, der überall durch die fadenscheinige Gemüthlichkeit durchblickt.“ Worüber auf der Bühne oft genug hinweggespielt wird, entgeht einer genauen Lektüre nicht: daß Nestroy „die Gemütlichkeit zuerst einseifte, wenn’s ans Halsabschneiden ging“ (Karl Kraus).