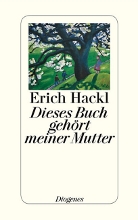Dieses Buch gehört meiner Mutter ist der programmatische Titel, angelehnt an ein Zitat von Bettina von Arnim, und weil dieses Buch seiner Mutter „gehört“, lässt Erich Hackl sie auch selbst sprechen. Das macht die Besonderheit des Buches aus: Es ist keine bloße Annäherung des Sohnes an die Mutter vom eigenen Standpunkt aus, sondern ein wahrhaftiges Eintauchen in die Welt der Mutter – perspektivisch und damit auch sprachlich. Und auch die besondere Form dieses schmalen Bandes erklärt sich aus der Wahl der Mutter-Perspektive: Dieses Buch gehört meiner Mutter ist ein knapp hundert Seiten langes Prosagedicht, das Anekdoten und Erinnerungen eben so aneinanderreiht, wie sie erzählt werden von jemandem, der sich, laut denkend, an längst Vergangenes erinnert, beim Sprechen immer wieder auch pausiert, nachdenkt, in sich hineinhorcht, von einer Geschichte zur nächsten kommt, ohne bewusst Zusammenhänge schaffen zu wollen, alles vollständig zu erklären. Entsprechend rhythmisch ist der Sprachduktus des ganzen Textes, entsprechend eigen das Vokabular, das im angehängten Glossar für Begriff-Stutzige für alle Nicht-Dialektkundigen erklärt wird.
Inhaltlich neu ist es freilich nicht, was die Mutter, die in Firling im unteren Mühlviertel, nahe der tschechischen Grenze in der Zwischenkriegszeit als Tochter von Wirtsleuten zur Welt kommt, über ihre Kindheit und Jugend in „ihrem“ Buch erzählt. Da gibt es Anekdoten aus der Kindheit, einige durchaus auch heiter, Erinnerungen an das Leben im Wirtshaus, an die Sensation des ersten Telefonapparats, an die harte bäuerlich-ländliche Routine, an die Erziehungsmethoden von damals, die Schule, die Dorfhierarchie, an den geliebten Hofhund Lord, das Tanzen und das Geschichtenerzählen, an den ersten Wien-Besuch, schließlich an den Zweiten Weltkrieg und an den jungen Mann, der sie nach dem Krieg heiratet, sie fortholt, womit diese ihre Welt und damit der Erzählfaden endet.
Solche Berichte über das harte, entbehrungsreiche Leben auf dem Land, und auch über die Rolle der Frau kennt man. Dass man der Erzählerstimme dennoch so bereitwillig folgt, wenn sie in unterschiedlich langen, zuweilen nur aus wenigen Sätzen bestehenden Erinnerungen, diese versunkene Welt in Worten auferstehen lässt, liegt daran, dass Hackl das Kunststück gelingt, die mütterlichen Erinnerungen sprachlich in eine Form zu gießen, von der ein ganz eigener Sog ausgeht. Diese durchaus mutige, bemerkenswerte lyrische Form, die schlichte, in ihrer Nüchternheit und Einfachheit schöne Sprache, der Sprachrhythmus, die Satzmelodie, das macht den Charme des Buches aus.
Selbst wenn Erich Hackl, Meister des dokumentarisch-nüchternen und zugleich immer warmherzigen Blicks auf seine Stoffe und Figuren sich so etwas Nahem, Privatem annimmt wie den Erinnerungen der eigenen Mutter, gelingt ihm der schwierige Spagat, den diese seine Art der dokumentarischen Nahaufnahme verlangt. Weder erliegt er der Versuchung, schreibend die mütterliche Welt allzu sehr zu verklären, noch wird der so persönliche Text von der Absicht, Beschwerlichkeiten, Leid und Missstände aufzuzeigen, die ja durchaus benannt werden, erdrückt.
Wenn Hackl gelegentlich in die Rede der Mutter als Autor eingreift, dann tut er das überaus behutsam, geradezu unmerklich – und doch bewusst. Er wollte, so schreibt er im Nachwort, sich die Freiheit nehmen, „ihr mein Gewissen anzudichten“, wollte ihr Einsichten gestatten, „die sie nicht auszudrücken vermochte oder zu denen sie nie gelangt ist“. Das ist sicher legitim, wahrscheinlich ist es sogar unvermeidlich, es erfordert allerdings Fingerspitzengefühl. Aber über das hat Hackl immer schon verfügt. So gewinnt der Text jene Tiefenschärfe, die Erich Hackls Texte immer ausmachen, und verliert doch nichts von jener Authentizität, die sie brauchen.