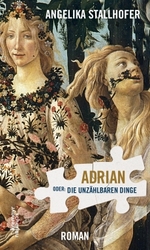Dieser neoliberale Feuchttraum ist in Angelika Stallhofers Debütroman Adrian oder: Die unzählbaren Dinge dabei, Wirklichkeit zu werden. Der Werbetexter und Ich-Erzähler Adrian Keller erhält von seiner Agentur den Auftrag, eine Probewoche im Musterhaus eines Immobilienmagnaten zu verbringen, der mithilfe der von Adrian geschaffenen Werbefigur Max Beier seine posturbanen Luxusgefängnisse unter die Mittelschicht bringen will. Adrian ist zunächst eher skeptisch, seine Beziehung zu der Schriftstellerin Anna zeigt ihm schon seit Längerem, dass es Lebensentwürfe auch gegen die falschen Versprechungen der Konsumgesellschaft geben kann. Aber das immer teurer werdende Pflegeheim für seinen Vater und auch die eigenen liebgewordenen Gewohnheiten des Alltags verhinderten bisher erfolgreich seinen Ausstieg aus dem real existierenden Irrsinn, der sich Erwerbsleben nennt. Die Projekte der Agentur werden immer ausufernder und zeitintensiver, und ähnlich wie Anna in ihre literarischen Fantasiewelten muss auch Adrian – wenn auch im Gegensatz zu ihr nicht freiwillig – immer mehr in seine Materie „eintauchen“, eine fragwürdige Empathie mit den Geschöpfen entwickeln, die die von ihm beworbenen Dinge – überteuertes Schuhwerk, Autos oder exklusive Uhren – erwerben und sich mit ihnen identifizieren sollen.
Anna, deren anspruchsvolle Bücher sich offenbar recht gut verkaufen und die von Adrian wegen ihres Geistes und ihres Mutes zur Unabhängigkeit bewundert wird, geht mit ihrem Kollegen Peer auf Lesereise, und Adrian muss sich zusätzlich zu seinen existenziellen und beruflichen Sorgen nun auch noch seiner Eifersucht stellen. So wird die Probewoche im Smart Home zu einem Spießrutenlauf zwischen den Manifestationen seiner selbst, der Kunstfigur Max Beier, die auf einmal ein erstaunliches Eigenleben zu führen beginnt, den wachtraumartigen Szenen aus Adrians Kindheit mit seinem problematischen Vater, der früh verstorbenen Mutter und der allwissenden Tante Grete, den plastisch präsenten Erinnerungen an Erlebnisse mit Anna und den Treffen mit einem geheimnisvollen Bekannten namens Gabriel, der nicht das ist, was er zu sein scheint. Von dreiunddreißig Kameras, der „Zauberhand“, einer eigensinnigen Smart Watch als einzigem Außenkommunikator, einem störrischen Kühlschrank und einem sprechenden Spiegel terrorisiert, beginnt er sich, sein Leben mit Anna und seine anderen privaten und beruflichen Beziehungen infrage zu stellen. Dabei kommt ihm nicht nur seine Contenance, sondern auch sein Selbstwertgefühl zunehmend abhanden. Als Adrian in einem Schrank seiner smarten Küche, der sich bislang nicht öffnen ließ, einen Revolver findet, scheint ein furioses Finale vorprogrammiert.
Der Roman beginnt mit einem nachdenklichen und, obwohl durchgehend im Präsens erzählt, mitunter sehr poetischen Ton, der die Handlung ganz eindeutig in einer realen, heutigen Welt ansiedelt. Doch das Geschehen gerät mit dem Einzug Adrians in das Smart Home immer mehr auf die Ebene des Phantastischen. Der Science Fiction-Faktor ist eher milde, schließlich liegen die beschriebenen Wohnideen ja schon seit einiger Zeit tatsächlich in der Luft; und doch evoziert die Autorin eine Atmosphäre der Beklemmung, die aus Huxleys Brave New World oder Juli Zehs Corpus Delicti herüberzuwehen scheint. Stallhofer gelingt es psychologisch dicht, den Kontrollverlust auf der Umgebungsebene literarisch mit dem Entgleiten des Protagonisten in fortschreitende innere Zerrüttung in Einklang zu bringen.
Die wichtigsten Konfliktlinien des Romans werden immer wieder durch das Aufrufen von im Gedächtnis des Protagonisten abgespeicherten Dingen und Begebenheiten gekennzeichnet. So spielen etwa regelmäßig wiederkehrend Zitronen, Dalís geschmolzene Uhren, Posts auf Facebook, das bei Stallhofer den sprechenden Namen „Panopticon“ trägt, aufgemalte Schiffe-versenken-Kästchen oder die Frage, welches Buch man als einziges vor der Vernichtung aller Bücher retten würde, eine Rolle. Auf diese Weise verschränkt Stallhofer geschickt, wenn auch auf Dauer vielleicht eine Spur zu offensichtlich, ihre Sujets und Charaktere miteinander.
Auf einer zweiten Ebene lässt sich das Buch aufgrund der Aussagen Annas zum Thema Schreiben beinahe wie eine Sammlung feinfühliger Bonmots über literarische Befindlichkeiten lesen. Auch haben ihre treffenden Personen-Charakterisierungen mitunter fast schon philosophische Qualitäten. So äußert sie sich einmal über Max Beier, Adrians Werbedummy: „‚Typen wie ihm‘, sagte Anna, ‚fehlt es an der Intelligenz, die es braucht, um sich zu verirren, an der Beweglichkeit der Gedanken, die man benötigt, um verloren zu gehen.'“
Wenn dann auch noch Stallhofers Lyrik, der Figur Annas in die Feder diktiert, in die Handlung eingeflochten wird, entstehen mitunter so denkwürdige Passagen wie dieses Gedicht über die eigene Beziehung zu Adrian:
„Ehe wir dachten, einander Liebe zu schulden,
war alles gut zwischen uns.
Ehe wir glaubten, glücklich sein zu müssen, waren wir froh.
Ehe wir meinten, einander Tür und Tor zu öffnen,
waren wir Verbündete.
Ehe wir die Aufrichtigkeit priesen,
fielen wir ehrlich übereinander her.
All die Dinge zwischen uns, die zuvor wie von selbst
geschehen waren: jetzt sind sie an guten Tagen das Werk
eines russischen Kunstfälschers, an schlechten Tagen
ein abgekartetes Spiel. Ich finde dich nicht mehr oft.
Und sag mir, wo wirst du sein, wenn der Hütchenspieler geht.“
Bei aller poetischen Finesse erliegt Stallhofer an einigen Stellen dann doch selbst den verbalen Gemeinplätzen ihres Protagonisten Adrian und legt, was seine Worte hätten sein können, auch noch der Antagonistin Anna in den Mund, wenn diese etwa bemerkt: „Es gibt nichts Schöneres (…) als den Tag mit einem Gedicht zu beginnen.“
Glücklicherweise bleiben solche Kleinigkeiten Episode. Stallhofer ist mit ihrem Roman ein bemerkenswertes erzählerisches Debüt gelungen, das aus einer dystopischen Thematik mit poetischer Schlichtheit, phantastisch-surrealen Assoziationsspielen und einer wohlkalkulierten Dosis literarischer Selbstreflexion eine packende Handlung entwickelt, die es sich leisten kann, gegen alle Erwartungen der Leserschaft ganz unblutig zu enden.