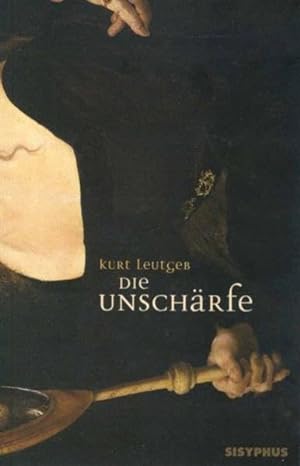Simon Riss stellt Reflexionen über die Freiheit des Menschen und die Allmacht Gottes an. Er findet Trost im Glauben und gewinnt den Eindruck, dass es ungeheuer wichtig sei, sich selbst seine gottgegebene Freiheit zu beweisen. Sein Ausweg aus der Krise liegt im Selbstmord, wodurch er beweist, dass es möglich ist, vor der errechneten Zeit zu sterben und den übrigen drei Thanatologen neue Hoffnung gibt, dass der errechnete Todeszeitpunkt doch nicht unverrückbar sei.
Viel spielt sich auf der Ebene der Sprache ab. So werden die Protagonisten häufig ohne Namensnennung nur als „er“ oder „sie“ eingeführt, was deren Unsicherheit oder Unausgeglichenheit widerspiegelt.
Felix Homerberg hingegen hat viele Namen und zugleich keinen: Einmal wird er als Felix, dann als Feliks bezeichnet, und sein Nachname wechselt zwischen Homerberg, Leonidovitsch und Leonidovitsch Gomerberg.
Auch die Nervosität der Protagonisten ist mitunter auf der sprachlichen Ebene spürbar, indem, wie in Hektik möglichst schnell gesprochen, zwei Wörter zusammengezogen werden („daist“ S. 84), „lossei“ S. 94).
Weitere Auffälligkeiten sind die durchgehaltene alte Rechtschreibung und die geschlechtsneutrale Sprache, wo etwa von „KollegInnen“ die Rede ist.
Als sich die vier Thanatologen am Tag ihres Todes wieder im Büro treffen, um den Selbstversuch zu wiederholen (was zu demselben Ergebnis führt), beginnen sie eine Diskussion über den Tod in der Literatur. Felix Homerberg hält einen Monolog über Elias Canettis Drama „Die Befristeten“, der mit einem Hölderlin-Zitat eingeleitet wird („Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ S. 57f), wobei Homerberg sowohl kritisiert („Eine offenkundige Schwäche von Canettis Stück besteht nun darin, dass die Hauptfigur, als sie in der Schlüsselszene des Werkes beschließt, ihre Kapsel zu öffnen, dies ohne allzu große Mühe zuwegebringt. […] Kein Mensch würde zögern, seine Kapsel zu öffnen, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Ebenso wird niemand zögern, für unsere SZB viel Geld auszugeben, obwohl die Auskunft in fast jedem Fall unangenehm sein wird.“ S. 58f) als auch lobt („Canetti hat nun meiner Meinung nach ganz vorzüglich imaginiert, wie sich die Usancen der Gesellschaft ändern müssen, damit sie sich der veränderten Situation anpasst, damit ihr also in der Gefahr das Rettende wächst.“ S. 59). Birgit Seismic greift das Thema auf und meint, dass Canettis Werk aussage, dass wir unser Schicksal beeinflussen könnten. Sie meint aber, „[…] daß wir zwar mit Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die mehrere Möglichkeiten offenlassen, operieren, um das Resultat zu ermitteln, das Resultat aber determiniert, das heißt durch unser Handeln nicht beeinflußbar ist. […] Sowenig wir beeinflussen können, wann wir geboren werden, können wir beeinflussen, wann wir sterben.“ (S.60).
Rainer Hartlieb wirft ein, dass man immer einsam sterben müsse, egal, ob man nun in Gesellschaft sei oder nicht. Er erklärt dies mit einem Satz Epicurs, der sagte, dass uns der Tod nicht betreffe, „denn wenn wir sind, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, sind wir nicht.“ Hartlieb meint nun, dass sich dieses Wir im Sterben aufhöre, dass jeder für sich sterben müsse. Wenn wir uns den Gesamtprozess des Überganges zwischen Leben und Tod als zwei Punkte, von denen einer „Leben“ und der andere „Tod“ bezeichnet, vorstellen, und den Abstand zwischen diesen beiden Punkten, den Weg von Leben nach Tod, als eine Linie, so ist diese Linie das Sterben. Hartlieb meint nun, dass Epicurs Satz wohl für die beiden Extreme, also für die Punkte Leben und Tod, gelte, nicht aber für den Übergang zwischen ihnen, das eigentliche Sterben. Simon Riss meint, dass Epicur hier Jesus nahe gestanden sei und erklärt, dass wir den Tod immer als den Tod eines anderen, nicht aber als den eigenen Tod denken. (Solange wir den Tod als den Tod eines anderen denken, betreffen uns nur die beiden Extrempunkte des Prozesses, nämlich entweder Leben oder Tod des Anderen. Den Übergang, das Sterben, gibt es nur in unserem eigenen Tod, weil er ein gänzlich einsamer Vorgang ist.)
Der Titel des Romans, Die Unschärfe, bezieht sich auf Heisenbergs Unschärferelation: Die Quantenmechanik sagt aus, dass prinzipiell jede Messung, die an einem quantenphysikalischen System vorgenommen wird, eine Störung desselben hervorruft, die umso größer ausfällt, je genauer die Messung durchgeführt wird. Die Unschärferelation ist nun jene Formel, die besagt, dass die Unbestimmtheit eines Teilchens einen gewissen Wert nicht unterschreiten kann.
Der Roman endet damit, dass es nach einer Kette erst durch den Versuch der Bestimmung des Todeszeitpunkts hervorgerufener Ereignisse zwar zu Toten kommt, Rainer Hartlieb, Feliks Homerberg und Birgit Seismic den Tag aber überleben. Auf die Heisenbergsche Unschärferelation bezogen lässt sich diese Tatsache damit erklären, dass die minutengenaue Bestimmung des Sterbezeitpunkts selbst das pünktliche Eintreten des Todes verhindert. Die Störungen, die die Messung am bemessenen System (dem Menschen) hervorruft werden etwa durch den vom Experiment bedingten Selbstmord Simon Riss‘ sichtbar.
Das vielleicht bemerkenswerteste Kapitel dieses Romans trägt den Titel „Intermezzo“. Darin taucht „ein Österreicher namens Kurt Leutgeb“ auf, der den Thanatologen „mit vom Rotwein gelöster Zunge“ erklärt, warum er von der Sinnlosigkeit des Wortes „Sinn“ überzeugt sei. Im Zuge seines Monologes kommt er auf John Cages Musikstück „Four minutes, thirty-three seconds“ zu sprechen. Dieses Stück besteht aus drei Sätzen, die zusammen vier Minuten und 33 Sekunden dauern und aus absoluter Stille bestehen. Kurt Leutgeb erklärt nun: „Vier Minuten dreiunddreißig Sekunden, das sind zweihundertdreiundsiebzig Sekunden. Zweihundertdreiundsiebzig ist eine sogenannte sphänische oder Keilzahl. Das sind Zahlen, die sich in drei Primfaktoren zerlegen lassen. Zweihundertdreiundsiebzig ist drei mal sieben mal dreizehn, daher die drei Sätze. Und – richtig! – minus zweihundertdreiundsiebzig komma eins fünf Grad Celsius, das ist der absolute Nullpunkt, null Kelvin. […] Am absoluten Nullpunkt gäbe es, wie im Vakuum, keine Töne. […] Der Gegensatz Klang – Stille ist nun aber unter den Voraussetzungen des Lebens unmöglich […]. Dafür, dass John Cage die fünfzehn Hundertstel Grad, die hinter der Kommastelle stehen, vernachlässigt hat, möchte ich ihn loben.“ (S. 107f) Kurt Leutgeb erklärt, dass Wirklichkeitsvermessung und Kunst kaum vereinbar seien und dass in der Regel nur Unpräzises ästhetisch schön sei. Dann kommt er wieder auf die Frage nach Sinnhaftigkeit zurück indem er meint, dass John Cage mit seinem Stück falschen Sinn schaffe, da die Maßeinheiten der Celsiusskala, die er in ein ästhetisches Werk umwandle, willkürlich seien. (Celsius hätte genauso gut einen anderen Wert als den Siedepunkt des Wassers definieren können, was John Cages Stück unmöglich gemacht hätte.) Leutgeb erklärt, dass er diesen erschwindelten Sinn intellektuell unredlich finde: „Als nächstes könnte ein Romanautor hergehen und seine ProtagonistInnen alle um vier Uhr dreiunddreißig sterben lassen, das sei via John Cage eine Anspielung auf den absoluten Nullpunkt, dem der Tod gleichkäme. Ein Kritiker würde die Anspielung bemerken, entzückt von der eigenen Gebildetheit, die ihm die Lektüre bewiesen hätte, einen Hymnus auf den Roman schreiben, und der Autor wäre ein gemachter Mann. Das wäre widerlich.“ (S. 108f). Der Autor ironisiert sich selbst, führt die Argumente der Romanfigur Kurt Leutgeb aber gleichzeitig ad absurdum, indem er den Todeszeitpunkt seiner Protagonisten schließlich nicht auf vier Uhr dreiunddreißig, sondern auf 17:33 ansetzt und stellt so wieder „Sinn“ an sich in Frage.
Der Roman lässt die Fragen, die er aufgeworfen hat, unbeantwortet. So wie die Protagonisten am Ende wieder am Anfang ihrer Forschungen stehen und beschließen, weiter nach einer Möglichkeit zur Sterbezeitbestimmung zu suchen, bleibt auch der Leser etwas ratlos zurück und sucht Antworten auf Fragen, die sich während des Lesens aufgedrängt haben – Antworten, die es vielleicht nie geben wird, was die Fragen aber nicht weniger spannend macht.