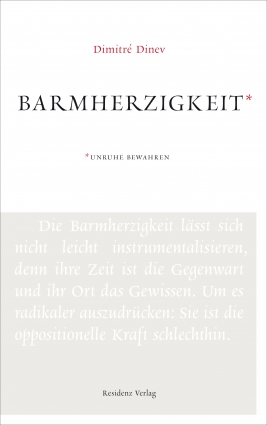In Marko Dinic‘ Debütroman Die guten Tage kommt keine Nostalgie auf, wenn der Ich-Erzähler sich an das Schuleschwänzen, Grasrauchen und Biertrinken erinnert, Treffpunkte in einem verkommenen Belgrader Vorstadtviertel. Ohnmächtige Aggression und der Hass auf die Väter, die Lehrer, die Männer vor allem, die nicht zu Identifikationsfiguren geworden sind in einem Land, in dem der Krieg noch nicht lange vorbei ist und die Kindheitserinnerungen mit Bomben verknüpft sind. Wer was im Krieg getan hat, wird vom Schweigen umhüllt. Ein nur allzu bekanntes Muster.
Der Ich-Erzähler ist kurz nach dem Schulabschluss ausgewandert, alleine, hat in Wien ein neues Leben begonnen – und wird doch das alte nicht los. In Wien wird er gefragt, wen er hasst: Kroaten, Albaner, Bosnier? Der Hass auf die eigenen Väter und Großväter, die das Land dorthin gebracht haben, wo es ist, ist da schon weniger vorgesehen, dafür umso präsenter im Roman. Orientierungslosigkeit ist Programm, nicht als Auswirkung der Migration, sondern als Ursache dafür. Der Erzähler ist noch kaum in Belgrad angekommen, da will er auch schon wieder weg.
Desillusioniert und zynisch beschreibt er seine Mitreisenden im „Gastarbeiterexpress“, erinnert er sich an seine Jugendzeit in Belgrad, an halbstarke Rebellion gegen das Machopatriarchat, die ihrerseits die nächste Generation an Machos hervorbringt. Der Sitznachbar aus dem Bus, der „einen persönlichen Krieg gegen alle und niemanden zu führen“ scheint, wirkt wie ein Alter Ego des Ich-Erzählers, wie der Teil des Selbst, den dieser gerne loswerden möchte.
Und doch sucht er das Belgrad, das er vor zehn Jahren verlassen hat. Die Stadt aber hat sich verändert und die Menschen mit ihr. Der Anlass für die Rückkehr ist ein trauriger: das Begräbnis der Großmutter, der einzigen Vertrauten in der Familie, der „Mäzenin“, die mit ihren Ersparnissen dem Enkel das Auswandern ermöglicht hat. Der Vater ist gebrechlich geworden, taugt nicht mehr so recht als Hassobjekt, die Verhältnisse haben sich geändert.
Durch den ganzen Roman zieht sich eine Zerrissenheit, ein Hin- und Her Geworfensein, das sich durch stete Schwenks zwischen Gegenwart und Vergangenheit, Begegnungen im Bus, der Schule, der Familie oder auch dem Umfeld in Wien (das aber wenig Gestalt annimmt) auch formal manifestiert. Es ist alles gleichzeitig da und nichts wirklich vergangen. Die Erinnerungen sind weitaus lebendiger (erzählt) als die Gegenwart.
Das alte, gewohnte, verhasste Belgrad hat der Ich-Erzähler mitgenommen nach Wien, es wird auf der Reise zurück wieder lebendig, doch hält es der Ankunft nicht stand. Je näher der Bus an Belgrad herankommt, desto präsenter wird das Leben in Wien, die Arbeit in der Bar, ganz okay, aber auch nichts, was er nicht missen möchte, nichts, was ihn hält.
Dinic erzählt von einer verlorenen, wütenden Generation, die keinen Halt findet, den Staat und die Eltern hasst und auch sich selbst, weil sie mit diesem Staat und diesen Eltern so verbunden ist. Es ist ein Generationenkonflikt und eine Abrechnung mit Krieg und Nachkriegszeit, dem Schönreden und Verschweigen von Verbrechen, dem Drücken vor Verantwortung, ein österreichisches Thema in einer neuen Variation.
Vor dem Selbst lässt sich ebenso wenig davonlaufen wie vor der Herkunft, der Vergangenheit oder der eigenen Familie. Aber die Perspektiven lassen sich verschieben und werden auch verschoben durch Zeit und durch Distanz: Die Eltern, vor allem der Vater, sind in den vergangenen zehn Jahren nachgerade geschrumpft, beinahe könnte der Hass schon einem – angewiderten – Mitleid weichen.
Der Ich-Erzähler bringt der Großmutter den Ehering seines Großvaters ans Sterbebett zurück, nachgerade ein Symbol für das, was ihn mit seiner Familie verbindet, für seine Vergangenheit, sein Aufwachsen in einem Umfeld, dem er nun erneut seine Verachtung so tief in den Rachen stopft, „dass ein lebendiger Mensch wohl daran erstickt wäre“. Mit der Großmutter wird begraben, was den Ich-Erzähler mit seiner Familie verbindet. Seine Eltern sind ihm fremd, die Verwandten empfindet er als feindselig.
Sein Hass richtet sich vor allem gegen ein Lebensgefühl, das ihn nicht loslassen will. Es ist Perspektivlosigkeit einer Generation, der man die Zukunft geraubt hat. Der Krieg hat Menschen, Städte und Illusionen zerstört. Dieser Zerstörung lässt sich nicht entkommen, schon gar nicht durch „ewiges Gastarbeitertum“.
Es gibt ein Weggehen, aber kein Ankommen.
Noch nicht.