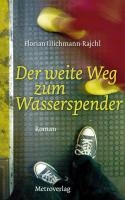Protagonist und Ich-Erzähler Lorenz Höfer ist Mitte dreißig und mit seiner Lebenspartnerin Nadja zusammen. Sie haben gemeinsam zwei kleine Kinder. Nach 15 Jahren des Veterinärmedizinstudiums nimmt Lorenz den Job in der MCA (Media Consult Austria) an. Er stellt passgenaue Presseschauen für Kunden in der Wirtschaft zusammen. Bald wird ihm klar, dass er kaum Rechte hat und von seinem Abteilungsleiter gegängelt wird. Denn Lorenz hat sich erlaubt zu beanstanden, dass es nicht genügend Bürostühle gibt. Auch am Wasserspender darf er sich nicht bedienen. Grund: Dieser ist nur für Angestellte. Diese Privilegien setzen sich auch in der Kantine fort: Dort ist der Eintritt von freien Mitarbeitern unerwünscht!
Nicht nur der Kampf zwischen freien Mitarbeitern und Angestellten wird auf absurde Weise illustriert, sondern auch die Konkurrenz unter den freien Mitarbeitern. Lorenz bemängelt die Solidarität untereinander; es wird kaum gesprochen. Nur mit Franz, der bald von MCA ausscheidet, versteht er sich gut. Und mit einer Kollegin spottet er gerne über die Leiter und manch andere Angestellte, bis diese Kollegin später einen der seltenen Angestelltenplätze bekommt – und ihn seitdem schikaniert …
Franz weist darauf hin, dass die freien Mitarbeiter sich nicht durchsetzen, weil die „Bobo“-Kinder ihren geringen Lohn als Taschengeld ansehen und zusätzlich von ihren Eltern gesponsert werden. Dieser Studentengeneration ist die Durchsetzung der Arbeitsrechte egal …
Doch „Don Quichotte“ Lorenz, der ein paar Jahre in der Firma bleibt, engagiert sich immer mehr und verbündet sich mit der Betriebsrätin. Plötzlich entsteht eine Dynamik in der Freie-Mitarbeiter-Belegschaft. Auch weil Lorenz erfährt, dass die Firma bald von Chinesen aufgekauft wird. Die Tätigkeit der „Freien“ wird dann automatisiert: Was also tun?
Autor Illichmann-Rajchl tut gut daran, die prekären und teils ausbeuterischen Job-Verhältnisse von freien Mitarbeitern zu beschreiben. Er schreibt auch aus eigener Erfahrung, und trotz der Schwere des Themas behält der Autor seine teils subtil-ironische, teils humorvolle Komponente. Etwa erinnert der Schluss mit „Zurück zur Natur“ und der Berufung auf Realwerte an Voltaires „Candide“… Denn Lorenz ist ähnlich wie Candide ein Getriebener – ein Getriebener der Gerechtigkeit.
Der Romandebütant greift ein Thema auf, das auch die Sardin Michela Murgia in „Camilla im Callcenterland“ (Wagenbach 2011) beschreibt – allerdings wesentlich sarkastischer. Auch sie schöpft aus eigener Erfahrung. Doch sie beschreibt vor allem Frauen, die auf den Job angewiesen sind. Das ist bei Illichmann-Rajchl anders – mit anderen Figuren wäre die Brisanz solch prekärer Verhältnisse noch deutlicher, schärfer. Schade!
Dennoch: Mit „Der weite Weg zum Wasserspender“ hat Illichmann-Rajchl ein treffendes und ironisches Debüt vorgelegt!