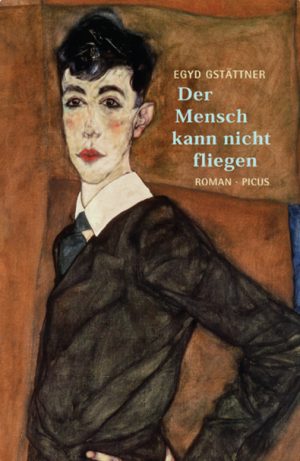Ein Jahrhundert später wandert ein Schriftsteller auf den Spuren Michelstaedters. Rasch erklärt sich das dem Roman vorangestellte ironische Zitat Oft frage ich mich, was wohl aus mir geworden wäre, hätte ich mich als junger Mann rechtzeitig umgebracht. Denn der Selbstmord des jungen Künstlers ist Schnitt- und Brennpunktpunkt für zahlreiche Fragen nach Kunst und Künstlerdasein, Sexualität, Isolation, Weltschmerz und Tod, die der Autor im Rückgriff auf zwei Schriftstellerexistenzen formuliert: Das Erzähler-Ich der Gegenwart und Carlo Michelstaedter loten – jeder für sich und dann zunehmend ineinander verschränkt – Antwortmöglichkeiten auf diese Fragen aus.
Michelstaedters Gedankengänge erfährt der Leser vor allem durch dessen Briefe an seinen Freund Vladimir, während der Erzähler diese ordnet, kommentiert und um eigene erweitert. Zunehmend wird die historische Gestalt Michelstaedters mit der Figur des Schriftstellers der Gegenwart verwoben. Während sie anfangs klar in jeweils eigene Kapitel getrennt sind, wechselt die Perspektive später zunehmend rasch und innerhalb von Abschnitten. So verschwimmen die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit, aber auch zwischen den literarischen Formen Brief, Kommentar, (Nach-)Erzählung. Vor Allem aber werden die Gedanken und Ideen nicht mehr klar dem einen oder dem anderen Schriftsteller zuordenbar.
Gstättner hält sich bei der Erzählung über Michelstaedters Leben meist ziemlich an die historischen Eckdaten – der einzige wirklich große fiktionale Eingriff in das reale Leben des Künstlers ist die historisch falsche Angabe des Elternberufes: während der deutsch-jüdische Vater des realen Michelstaedter ein Versicherungsbüro leitete, besitzen die fiktionalen Eltern einen Friseurladen. Da dies eine enorme psychologische Auswirkung auf den fiktionalen Michelstaedter hat, geht dieser Kniff über einen rein komödiantischen hinaus. Das Friseurdasein wird als radikaler Gegenentwurf zum Künstlerdasein ent- und daher voller Zorn vom jungen Michelstaedter verworfen: Seinen Vater und mich hat er Haarschneide maschinen genannt, Inspektor, was sagen Sie dazu? Wie man nur Friseur werden kann, hat er mich gefragt. Ein Leben lang mit fremden, klobigen Menschenschädeln sein, hat er gesagt, mit der knöchernen Verpackung ordinärer Gehirne, Abgabestelle von Tränenflüssigkeit, Rotz und Speichel. (S. 179)
Egyd Gstättners Erzählduktus springt immer wieder zwischen komödiantischer Groteske und Tragik, so reiht er in seinem Roman salopp und ironisch formulierte Pointen und Anekdoten aneinander. Für den schokoladesüchtigen Michelstaedter wird das Wien der Jahrhundertwende zu einem pittoresken Schauplatz für erste sexuelle Erfahrungen, umringt von einer Prostituierten, ihrer Zuhälter-Mutter und niemand geringerem als Sigmund Freud selbst muss er in der Berggasse erste Lust- und Frusterlebnisse durchstehen. Neben Freud findet sich hier auch die Elite der künstlerisch-intellektuellen Wiener Jahrhundertwende wieder: Franz Weigel, Klimt, Schiele, Kokoschka, Mahler sind die Namen, die dem Leser vorgeworfen werden. An Verweisen auf Literatur, bildende Kunst und Musik mangelt es nicht in dem Roman, auch bietet der Autor zur Genüge autoreferentielle Textstellen, in denen der Literat und Maler Michelstaedter mit dem Erzähler-Ich (der dessen Geschichte verfassen möchte) als Spielfiguren das Gefüge Autor-Erzähler-Erzählter immer wieder witzig, hin und wieder allerdings bereits zu aufdringlich, durchbrechen.
Die Philosophien, mit denen sich der reale Michelstaedter beschäftigte, werden dagegen nicht nur schlaglichtartig aufgeworfen, sondern – und dies ist die eigentliche Leistung des Romans – ausführlich befragt und kommentiert. Die Dissertation, Briefe sowie Zitate aus dem realen Werk des Künstlers dienen dieser Befragung ebenso wie die ironisch gebrochene und teils skurille und bewusst patzige Neuschreibung dieser Fragen nach Existenz, Philosophie, Kunst.
Die Liebe zu Schopenhauer (die auch der reale Michelstaedter pflegte) ist dabei wesentlich: Schopenhauer liebt die Kunst nicht als Schmuck, als Erholung fürs Leben, sondern er liebt sie gegen das Leben, als ein Vorschein der Erlösung von der Mühsal und Qual des Lebenswillens. schreibt Michelstaedter an seinen Freund. Schopenhauer wird damit zum Erklärungsmodell für die depressive, an „Weltschmerz“ leidende Grundstimmung, die der junge Michelstaedter nahezu durchwegs an den Tag legt.
Der Schmerz des Lebens lässt sich nicht abwälzen, sagt Schopenhauer. Alle Bemühungen dazu leisten nichts, als dass er seine Gestalt verändert. Diese ist ursprünglich Mangel, Not, Sorge um Erhaltung des Lebens. Kaum in dieser Gestalt verdrängt, erscheint der Schmerz sukzessive als Geschlechtstrieb, Liebe, Eifersucht, Neid, Ehrgeiz, Geiz, Sorge, Hass, Angst, Krankheit und so in noch unzähligen Gestalten. Hat man ihn in allen überwunden, so nimmt er zuletzt die der Langeweile an. Und gelingt es, diese zu besiegen, so wird es schwerlich geschehen, ohne wieder den Schmerz in einigen der vorigen Gestalten einzulassen und so den Tanz von vorne zu beginnen. Solche Sätze schlagen ein in das Gehirn eines jungen Menschen, Vladimiro! Solche Sätze sind natürlich keine Sätze für Friseure. Und keine für Friseursgattinnen. (S. 19)
Die Friseurgattin, also die Mutter, ist in jeder Hinsicht ein Gegenpol ihres Sohnes: wo sie bodenständig, erfolgreich, praktisch veranlagt ist, ist er weltfremd, isoliert, vergeistigt. Als deutlichstes Motiv und als Auslöser, wenn nicht gar die wesentlichste Ursache für den Selbstmord des Künstlers wird in zahlreichen inneren Monologen und Briefen Michelstaedters eben diese verhasste Mutterfigur herausgeschält, von der Michelstaedter mit seinen 23 Jahren immer noch finanziell und psychisch abhängig ist. Als Muttersöhnchen, Menschenangsthase, Weltschmerzling, Einzelhäftling, Isolationsopfer, Ausgeschlossener, Verbannter (S. 189) scheitert er an einer von der Mutter, pragmatischen Universitätsprofessoren, Beamten, Politikern und Erfolgsmenschen getragenen Realität, die seine Philosophie und Kunst in keiner Weise verstehen oder würdigen kann. So stellt er über seine Dissertation fest:
Diese biografischen Skizzen sind natürlich nicht der richtige Platz, mich über ihren Inhalt zu verbreiten. Hier reicht es zu sagen, dass es mir um die Auslotung der existenziellen Grundmöglichkeiten des Daseins geht, um die vollkommene Einheit von Philosophie und Leben und um die Möglichkeit des Selbstseins in eigener Verantwortung. Welche größere Aufgabe kann ein Mensch haben, als sich durch permanente Selbstvergewisserung von der Bedürftigkeit des Lebens zu befreien? Die Existenz des Menschen ist frei – und unendlich dunkel. Aus einer pragmatischen Perspektive könnte man freilich auch sagen: Meine Tesi ist völlig überflüssig. (S. 167)
An diesem Pragmatismus geht Michelstaedter letztendlich zu Grunde. Unerfüllte Sehnsüchte, gescheiterte Sinnsuche, sexuelle Frustration, die Rückkehr in die Enge der Provinzstadt Görz und diese typisch Freudsche dominante Monstermutter (S. 194) formen die Psyche des jungen Michelstaedter, dessen Selbstmord letztendlich unausweichlich erscheint. Im letzten Kapitel entwirft der Ich-Erzähler in der letzten Sekunde vor dem Abdrücken der Pistole mögliche Lebensentwürfe Michelstaedters. Allesamt sind sie eher bedrohende als wünschenswerte Perspektiven: Frust, ewiger Kampf mit dem Überlebenspragmatismus sowie die historische Realität des beginnenden 20. Jahrhunderts machen diese Vision des Weiterlebens zu einem Horrorszenario. So wirkt es beinahe wie eine Erleichterung, dass der junge Michelstaedter diese frustrierenden Möglichkeiten nicht ausleben musste, und der Leser erinnert sich nach der mit dem Selbstmord des Künstlers endenden Lektüre wieder an deren Anfang: Oft frage ich mich, was wohl aus mir geworden wäre, hätte ich mich als junger Mann rechtzeitig umgebracht.