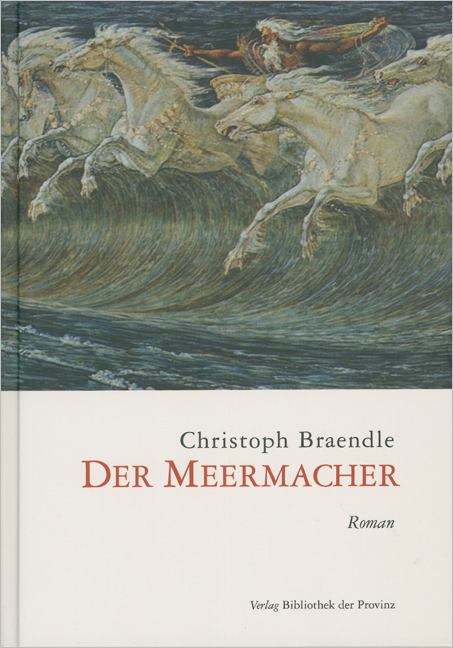Der Roman nimmt sich des sehr aktuellen Themas einer Klimakatastrophe an, belässt es aber nicht dabei. Die Katastrophe wird biblisch festgemacht: das gehäufte Zitieren der testamentarischen Sintflut durch eine Gruppe von (zunächst verrückt wirkenden) Protagonisten – drei gewaltbereite Jugendliche – deutet dies bereits an, am Ende steht die Rettung einiger weniger Menschen in der von eben diesen Jugendlichen erbauten Arche Noah. Die Überlebenden sind – neben Gustav und seiner Frau Gerlinde sowie den drei Halbstarken Schlägern – nur noch Fische in den Aquarien der Arche.
Dieser Sintflut geht eine Geschäftsidee voraus: André, der Jugendfreund Gustavs, ein erfolgreicher Investment-Unternehmer, beschließt, im Garten Gustavs ein Zentralmeer zu schaffen: das kurble den Tourismus an und stille die Sehnsucht der Menschen nach Ruhe und der Schönheit des Meeres, so André. Dieser Entscheidung wiederum geht eine nicht stattgefunden habende Urlaubsreise des Ehepaares Gustav und Gerlinde in die Karibik voraus, die zum Ehekrach geführt und Gustav mit einer immensen (Ersatz-)Sehnsucht nach Meer zurückgelassen hat. Die Ehekrise zentriert sich u. a. um einen Rosenstock, der das eheliche Idyll, das gemeinsam erarbeitete Heim mit Garten symbolisiert und gleichzeitig die Entfremdung der Ehepartner Gustav und Gerlinde voneinander, aber auch von ehemaligen Freunden und Freundinnen, thematisiert.
Unvorsichtigerweise eröffnet Gustav seine Sehnsucht nach Meer eines Nachts, am Tiefpunkt angelangt, von seiner Frau verlassen und dem Alkohol zugetan, seinem Jugendfreund André. Ergebnis dieses Gespräches ist bald darauf ein Vertrag, der die Geschäftsidee „Zentralmeer“ samt dazugehöriger Stiftung beschließt. Hier setzt die Erzählung vom scheinbar sich erfüllenden amerikanische Traum ein und wird in raschen Abfolgen durchgespielt: Vertragsunterzeichnung, Jubel, Sekt, rasend schneller Aufstieg in die High Society, in die Welt der Hotels und schönen Frauen, Überangebot an Sex, Aussicht auf immer mehr Prestige und Geld. Gustavs Traum vom Meer, das er bisher nur aus einem immer wieder eskapistisch angesehenen Videofilm über die Karibik kannte, scheint ein Knüller zu sein, wobei durch den Erfolg, den er dabei erzielt, sein ursprüngliches Ziel immer mehr in den Hintergrund gerät und Ruhm und Geld wichtiger werden.
Der aufmerksame Leser, der die Zeichen des Unheils in den Zitaten der gewaltbereiten Jugendlichen deutet, ahnt bereits, dass dies kein gutes Ende nehmen kann. So erstaunt es letztendlich kaum noch, dass das Projekt zum Albtraum ausufert. Der Bau des Meeres und dazugehöriger Anlagen mit Casino wird vom andauernden Regen, der sich zu einer Umweltkatastrophe mausert, boykottiert; der charismatische André stellt sich rasch als aalglatter, profitgeiler Geschäftemacher heraus, der Gustav in den Ruin treiben lässt und auch vor Mord nicht zurückschreckt. Ein recht simpel gestricktes Sprachspiel dient hier als plakativer Aufhänger: das so sehnsüchtig begehrte Meer ist von den Geschäftskollegen und von André anders verstanden worden – in der (Geschäfts-)Welt geht es nicht um das Meer, sondern um das Mehr. Da sich auch dieses Spiel mit der Phonetik bereits von Anfang an in den Kapitelüberschriften wieder findet (Nie Meer, Viel Meer, Immer Meer) erstaunt es nicht, dass die Erfahrungswelten Gustavs mit denen der Geschäftswelt am Ende nicht übereinstimmen. Bereits am Anfang ist es aber auch Gustav selbst, der seiner Frau gegenüber überschwänglich formuliert, es gehe ihm „um mehr und ums Mehr recht eigentlich, wenn man das kleine Sprachspiel erlaube, welches Meer ja …“ (23). Dieses begehrte Meer wird am Ende die ganze Erdoberfläche bedecken, so beendet das „Meerchen“, das einst André Gustav gegenüber als „kein Märchen“ (97) bezeichnete, alle Märchen von der Übermacht des Menschen über die Natur, von der Kontrollierbarkeit der turbokapitalistischen Märkte oder – banaler – der Käuflichkeit und freien Erschaffbarkeit der Welt.
Die Moral der Geschichte scheint darin zu liegen, dass die Profitgier, die jedes Maß verloren hat und in Form von André auch vor Umweltschäden und Mord nicht zurückschreckt, nahezu zwangsweise (auch der Logik des Romans folgend) mit der Sintflut bestraft werden muss. Dieses wenig überraschende Ende wird nicht zuletzt durch die stetige Erwähnung des andauernden Regens vorweggenommen, der unschwer erahnen lässt, wie die von manchen Protagonisten herbeizitierte Apokalypse aussehen wird.
Auserwähltheitsmythen, die nur wenige Menschen als überlebenswert beschreiben, haftet immer etwas Problematisches an. Während literarische Fiktionen geradezu ein idealer Ort für subversive und auch polarisierende Erzählungen sein können, enttäuschen in diesem Roman die moralisiernde Ebene, die behauptete Auserwähltheit der fünf Überlebenden und die Vorhersehbarkeit des Geschehens. Die Parallelen der inszenierten Sintflut zu den Umweltkatastrophen der Gegenwart eröffnen sich natürlich zwangsweise, jene zur gegenwärtigen Finanzkrise bieten sich ebenfalls an. Eine radikale Auseinandersetzung mit den gestellten Fragen wird aber leider verhindert. Als witziger und origineller Abschluss lässt sich der Schlussakt lesen, wenn Gustav nach der Sintflut, die die Erde völlig unter Wasser gesetzt hat, aufs offene Meer hinaussieht und feststellen muss, dass die Arche auf einem anderen Planeten gelandet ist: auf einem Planeten mit zwei Sonnen.
Der Roman wirft allerdings tatsächlich wesentliche Fragen auf: der Spannungsbogen von der Apokalypse als prägendem Wahrnehmungsmuster von Sünde und Strafe bis zur Gegenwart des (Turbo-)Kapitalismus, der gesellschaftlichen Ignoranz gegenüber Umweltzerstörung und den daraus resultierenden sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Katastrophen, bietet brisanten Stoff – obwohl gerade die Parallele von heutigen Flutkatastrophen und der biblischen Sintflut als wenig originell gelten muss, weil sie medial in den letzten Jahren häufig angestellt wurde.
Dennoch kann Der Meermacher als denkenswerter Impuls und als sprachlich großteils spannender Roman herausgestrichen werden. Ob man ihn wie Jens Jessen in Die Zeit (Nr. 13) als geniale prophetische Warnung lesen will, als aktualisiertes biblisches Gleichnis, als versuchte Science-Fiction-Erzählung mit sozialkritischer Implikation oder als doch mehr oder weniger geglücktes Zusammenschreiben all dieser Momente, bleibt dem Leser / der Leserin selbst überlassen.