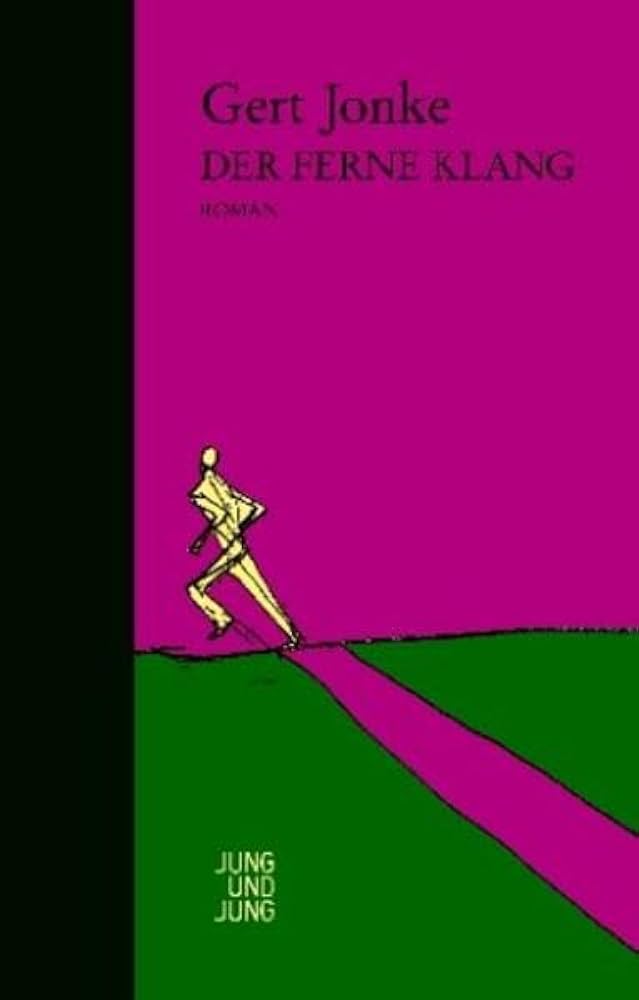Das Buch beginnt in einem Zustand, der zwischen Schlafen und Wachen, Traum und Wirklichkeit liegt: Ein Mann in mittleren Jahren – von berufs wegen ist er Komponist, allerdings will er nicht mehr komponieren – erwacht in einem Krankenhauszimmer ohne recht zu wissen, warum er dorthin eigentlich gekommen ist. Die Ärzte sagen ihm, daß er versucht habe, sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben zu nehmen. Er selbst kann sich daran jedoch absolut nicht mehr erinnern. Ja mehr: Er behauptet felsenfest, daß der methodische Wahnsinn, dem er unterliegt, einen solchen Selbstmordversuch für ihn völlig unmöglich scheinen läßt.
Die Argumente stehen kreuz und bieten die Voraussetzung für alle weiteren Paradoxien des Buches. Von der äußeren Handlung her passiert im „fernen Klang“ nicht viel: Der Komponist verliebt sich nach dem Aufwachen in eine Krankenschwester, die dann aber plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Um die Frau wiederzufinden, bricht der Mann zu einer Reise auf. Dabei schließt er sich unter anderem einer Schauspieler- und Jahrmarktstruppe an. Schließlich endet alles in einem traumhaft/wachem Volksfest, im Zuge dessen zwar die Angebetete wiederkehrt, der Mann sie aber dennoch nicht zu fassen kriegt.
Wichtiger als die große Geschichte sind die vielen kleinen Geschichten, die Jonke um sie herum erzählt. Diese Geschichten (und oft auch nur die Andeutung von Geschichten) werden vom Autor kunstvoll parallel geführt, teilweise ergänzen und unterbrechen sie einander, sodaß insgesamt ein zwar dichtes, aber doch wenig definitives Gewebe von Ereignissen entsteht.
Symptomatisch für den labyrinthischen Charakter des Buches ist eine Episode, die man sich wahrscheinlich am besten erklären kann, wenn man die verkehrstechnischen Gegebenheiten der österreichischen Bundeshauptstadt kennt. Ohne Zweifel standen diese für die folgende Begebenheit Pate: Die Hauptfigur des „fernen Klanges“ fährt vom „Südbahnhof“ einer Stadt weg und kehrt, nachdem der Zug eine Umleitungsschleife zu ziehen gezwungen war, auf den „Ostbahnhof“ zurück. Nach der Ankunft durchschreitet der Mann die Bahnhofshalle und stellt zu seiner großen Überraschung fest, daß der „Ostbahnhof“ der Stadt gleichzeitig deren „Südbahnhof“ ist und er rein äußerlich keinen Meter vorangekommen ist.
Während sich außen vieles im Kreis und um sich selbst bewegt, spielen sich die wahren Bewegungen im Inneren der Sprache und damit auch im Inneren der Hauptfigur ab. „Der ferne Klang“ ist ein Buch, in dem die Hauptfigur (und mit ihr der Autor) über weite Strecken einzig damit beschäftigt ist, sich seiner selbst und seiner Umgebung zu vergewissern. Entscheidend ist dabei nicht so sehr, daß, sondern wie das ganze vonstatten geht: In einer entsprechenden Wendung heißt es, daß man sich dem Ich eben niemals per „Du“, sondern immer nur „per Sie“ annähern kann. Mit anderen Worten: Zur Klärung dessen, was eigene Identität sei, ist eben nicht ein ungestüm-heftiges, sondern ein langsam-tastendes Herangehen zielführend.
Der „Ferne Klang“ entwirft das Bild einer anderen Wirklichkeit in sanfter Weise und überzeugt solcherart bei aller Surrealität im Detail. Dafür mag ausschlaggebend sein, daß es keine Launen und Capriccios sind, sondern genaue Beobachtungen, auf denen die Jonkeschen Wirklichkeitsauflösungen basieren. Von sogenannter „Genauigkeitsschlamperei“ spricht der Autor im „fernen Klang“, und die Lektüre des Romans zeigt, daß nicht nur dieser Begriff zutrifft, sondern auch die Weiterung, die an ihm in typisch Jonkescher Wortbildungsmanier unternommen wird: Im „fernen Klang“ ist auch heute noch ein großer und virtuoser „Genauigkeitsschlampereifanatiker“ zu entdecken.