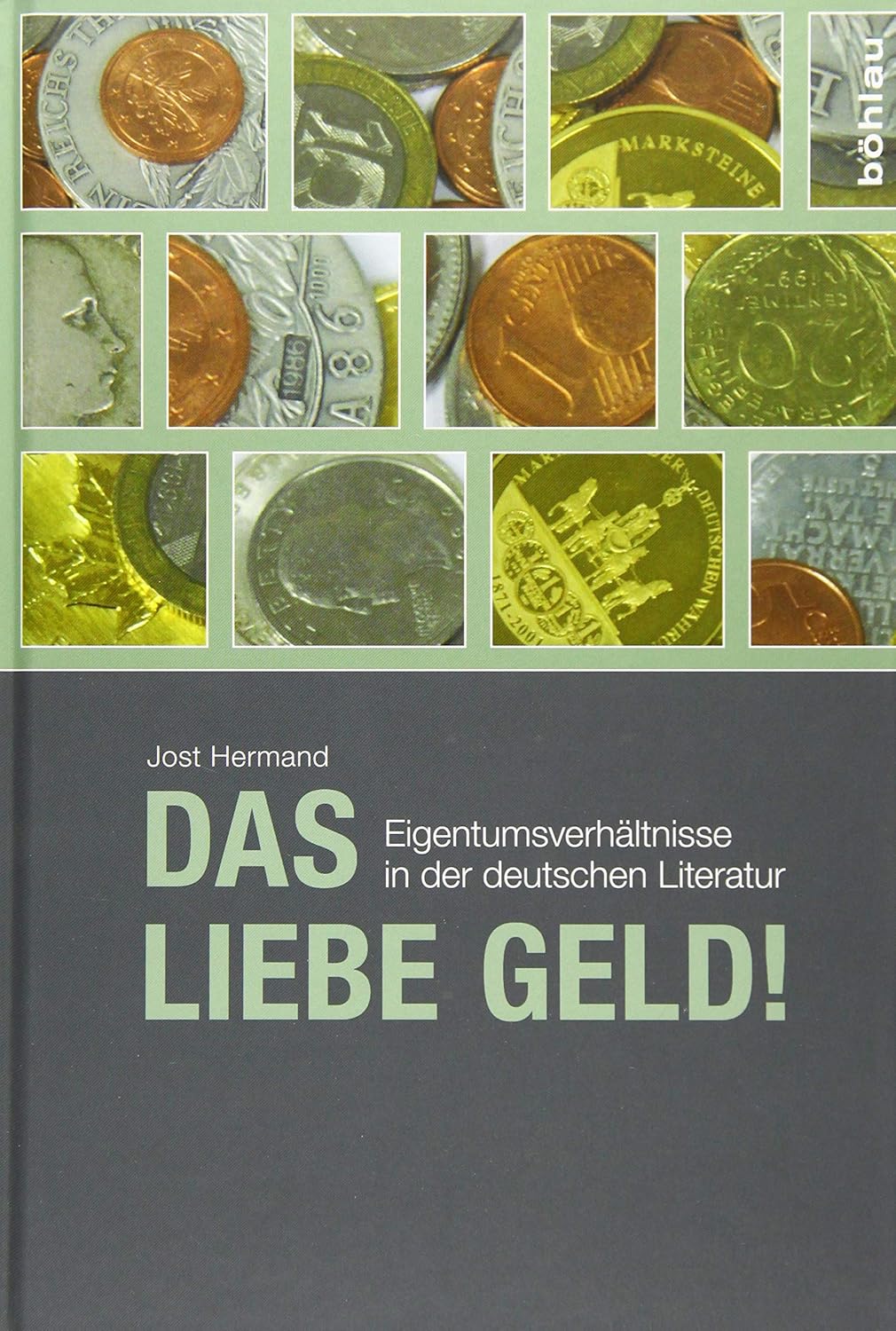Jost Hermand jedenfalls, im Selbstverständnis „gesellschaftsverpflichtete[r] Literaturwissenschaftler“ (S. 9), ist in der vorliegenden Untersuchung, wie der Untertitel verspricht, fokussiert auf die Thematisierung der ungleichen „Eigentumsverhältnisse in der deutschen Literatur“ seit dem „erste[n] deutsche[n] Kaufmannsroman“ (S. 30), der bereits um 1220 verfassten Erzählung Der guote Gerhard des Rudolf von Ems. In einem einleitenden „Abriß“ (S. 7-29) unter dem das Erkenntnisinteresse des Verfassers deutlich deklarierenden Titel „Literarische Widerspiegelungen sozioökonomischer Prozesse vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart“ bietet Hermand einen Überblick, der nicht durch neue Einsichten besticht, sich jedoch bestens als informative und gut lesbare Einführung für Studierende in Zusammenhänge zwischen eben soziökonomischen Bedingungen und literarischen Erscheinungen eignet. Der Überblick setzt mit dem Mittelalter ein, in dem ungleiche Besitzverhältnisse kein Thema sind, solange die Auffassung herrscht, dass jeder im göttlich gewollten ordo universalis seinen Platz innehat, der Bettler so gut wie der Fürst. Hermand verfolgt weiters diverse gesellschaftliche Strukturwandel (beginnend mit dem hin zu einer ständischen Ordnung in den wachsenden Städten seit dem 12. Jahrhundert), befragt umwälzende politische Ereignisse wie die Katastrophen des Dreißigjährigen Krieges und seiner Folgen oder die Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress, die Weltkriege im 20. Jahrhundert sowie wirtschaftliche Umbrüche (in den 1920er/30er Jahren oder durch die Krise der Finanzmärkte nach 2008) nach ihrer Bedeutung für die Literatur. Am Beispiel von zwanzig Texten beobachtet Hermand die angesprochenen Zusammenhänge. Unter dem von ihm gewählten Blickwinkel erscheint die Frage nach den ästhetischen Qualitäten der jeweiligen Texte zwangsläufig sekundär. Jedes der einzelnen Kapitel geht aber vor der Auseinandersetzung mit den Werken sehr genau auf die zugrunde liegenden politischen und ökonomischen Verhältnisse ein.
Wissenschaftsgeschichtlich interessant ist, dass die Thematisierung ökonomischer Bedingungen im Guoten Gerhard des Rudolf von Ems erst nach der NS-Zeit Aufmerksamkeit gefunden hat. Wiewohl in diesem Text aus dem 13. Jahrhundert an der göttlichen Ordnung nicht gerüttelt wird, erscheint die Wertschätzung des erfolgreich profitorientiert Handel treibenden, auch politisch nicht einflusslosen Kölner Patriziers bemerkenswert, wodurch der Text quer liegt zur übrigen weltlichen Literatur der Zeit wie beispielsweise zu der etwa gleichzeitig mit dem Guoten Gerhard entstandenen Spruchsammlung Freidanks Bescheidenheit. Mit dem Erstarken des Bürgertums ab dem späten Mittelalter und mit seinem dank der Reformation wachsenden politischen Selbstbewusstsein wird kaufmännischer Erfolg, so er sich ehrlichem Wirtschaften verdankt, immer positiver bewertet. Die veränderte Einstellung beobachtet Hermand insbesondere an mehr als zwanzig Dramatisierungen der Parabel Vom verlorenen Sohn, die dem pädagogischen Anliegen der Beförderung einer dem „Lotterleben“ (S. 50) entgegenwirkenden „bürgerlichen Arbeitsethik“ (S. 45) dienen. Hans Sachs wäre mit einem einschlägigen Werk zu nennen, besonders aber Jörg Wickram mit seinem „Bürgerspiel“ Ein schönes und Evangelisch Spiel von dem verlornen sun (1540) und seinem Roman Der Jungen Knaben Spiegel (1554). Hier wie dort spielt der Bildungsaspekt eine zentrale, das Monetäre eine untergeordnete Rolle. Allerdings gilt für alle Dramatisierungen, dass sie – der Reformation verpflichtet – katholische Positionen ablehnen, insbesondere den Ablasshandel. Die religiösen Streitigkeiten nach dem Prinzip des „Cuius regio, eius religo“ gipfelten im 17. Jahrhundert im Dreißigjährigen Krieg. Kein Autor seiner Zeit hat die soziökonomischen Bedingungen so präzise erfasst wie Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen. So schon in seiner Histori vom Keuschen Joseph (1666), deren Titelfigur als Homo oeconomicus Hermand geradezu als „ein marktwirtschaftlich orientierter Manager“ (S. 58) erscheint. Aufschlussreicher bezüglich der Eigentumsverhältnisse ist allerdings Grimmelshausens Roman Trutz Simplex (1670), dessen hier aufgrund seiner Länge nicht wiederzugebender Titel schon andeutet, was der Text ausführt, dass nämlich ehrliches kaufmännisches Agieren unter den gegebenen Bedingungen unmöglich ist und dass die Skrupellosigkeit gängiger Verhaltensweisen der Zeit der politischen und gesellschaftlichen Situation während des Dreißigjährigen Krieges entspricht.
Eine ähnlich herausragende Stellung wie Grimmelshausen spricht Hermand innerhalb der Literatur des 18. Jahrhunderts Gotthold Ephraim Lessing mit seiner Komödie Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück (1767) zu, an der er den realistischen Zeitbezug bestechend findet. Zentral ist in diesem Stück sei der monetäre Aspekt mit seinen Auswirkungen sowohl auf das Ehrgefühl des Majors und als auch auf dessen Liebesbeziehung zu Minna. Während Lessing Vermögensverhältnisse problematisiert, kann Hermand bei den Klassikern Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller kein Interesse an deren Veränderung beobachten. Dies gelte speziell für die Xenien (1796/97), die schärfstens gegen alle gerichtet sind, die an den „feudal absolutistischen Herrschafts- und Eigentumsverhältnissen in Deutschland“ (S. 82) zu rütteln versuchen. Entschieden wenden sich die beiden Klassiker gegen die Ideale der Französischen Revolution insbesondere im Epos Hermann und Dorothea (1797) sowie im lange zum Kanon der deutschen Literatur gehörenden Gedicht Das Lied von der Glocke (1799). Darauf, dass das etwa Heinrich Heine in der Romantischen Schule in bezug auf Schiller anders gesehen hat, geht Hermand allerdings so wenig ein wie auf die Thematisierung der Geldproblematik in Faust II.
Die Literatur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt unterschiedlichste Ausrichtungen, vieles erscheint erzkonservativ und reaktionär, vieles auch „weltschmerzlerisch“ (S. 93), vergleichsweise nur wenig hingegen vormärzlich liberal, auf Demokratisierung hoffend. Hermand spricht sich gegen literarhistorische Schubladisierungen („Biedermeier“, „Vormärz“) und für die Beachtung der unterschiedlichen Reaktionen auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse aus. In Karl Leberecht Immermann sieht er einen „gemäßigt-liberale[n] Autor“ (S. 95), dessen unentschiedene Haltung für seinen Roman Die Epigonen (1836) bezeichnend ist. Literarisch eher rückwärtsgewandt, hat der Autor durchaus einen Blick für gesellschaftspolitische Veränderungen wie die Ablöse des alten Adels durch den großbürgerlichen Geldadel oder die ausbeuterischen industriellen Arbeitsverhältnisse, ohne jedoch von „utopischen Vorscheinhoffnungen“ (S. 97) geleitet zu sein. Keinen Blick für die Lebensbedingungen des Proletariats hat Gustav Freytag in seinem „bürgerliches Standesbewußtsein“ (S. 105) demonstrierenden Roman Soll und Haben (1855), der sehr genau den wirtschaftlichen Erfolg des Kapitalismus und damit des Bürgertums und das Verbleiben der politischen Macht beim Adel erfasst. Bezeichnend die geradezu neoliberal klingende Forderung, „das Geld soll[e] frei dahin rollen“ (S. 110). Die kritische Analyse der Parvenügesellschaft zeichnet Theodor Fontanes Roman Frau Jenny Treibel oder: „Wo sich Herz zum Herzen find’t“ (1892) aus, dessen Untertitel nur ironisch verstanden werden kann, regieren doch nicht Gefühle, vielmehr das liebe Geld, so dass sich – so könnte man pointiert sagen – nicht Herz zum Herzen, sondern Besitz zu Besitz findet. Hermand vermisst allerdings an Fontanes Roman ein positives gesellschaftspolitisches „Leitbild“, bestimmend bleibe „ein resignierender Relativismus aller Werte“ (S. 137). In Gerhard Hauptmann hingegen sieht er den Vorreiter eines „sozialdemokratisch orientierten Naturalismus“ (S. 143), dessen Drama Vor Sonnenaufgang (1889) nicht nur revolutionäre Attitüde prägt, sondern konkret Eigentumsverhältnisse beleuchtet, Partei für das Proletariat ergreift und sich gegen das Parvenühafte des Großbürgertums sowie gegen martialischen Hurrapatriotismus wendet. Der kritische Impuls des Naturalismus verpuffte sehr rasch, unter den wenigen Schriften, die sich mit der Situation der Industriearbeiter befasst, hebt Hermand Carl Fischers autobiographisches Werk Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters (1903), das ein beachtliches politisches Bewusstsein des Autors, wenn auch kein ausgefeiltes ideologisches Konzept auszeichnet.
Im einzigen nicht einem Autor gewidmeten Kapitel spürt Hermand dem Ursachensyndrom für die kriegsbegeisterte Bewegung vor und zu Beginn des Ersten Weltkriegs nach. Sehr ausführlich, differenziert und überzeugend werden die von der Großindustrie entschieden unterstützten imperialistischen Tendenzen unter Wilhelm II. und fragwürdige politische Positionen wie die Legitimation der Ausbeutung des Proletariats sowie rassistischer Einstellungen durch sozialdarwinistische Argumentation aufgerollt, die unrühmliche Rolle des Habsburger Reichs im Vorfeld des Kriegs allerdings völlig außer acht gelassen. In Impressionismus und Jugendstil sieht Hermand einen Rückzug auf ästhetizistische Positionen ohne Blick für die politischen und sozioökonomischen Bedingungen. Das Kippen der Stimmung im Weltkrieg löst bei der Masse keine revolutionäre Bereitschaft aus, im künstlerischen Bereich dominiert vages expressionistisches Pathos. So bei Georg Kaiser, der im Stationendrama Von morgens bis mitternachts (1912) noch stark ichorientiert ist und auch im Drama Die Koralle (1917), wiewohl Eigentumsverhältnisse angesprochen werden, eher psychologisch als sozialkritisch ausgerichtet ist. In Gas sowie Gas II lässt sich zwar „zweifellos eine antikapitalistische Tendenz“ (S. 178) erkennen, aber die Alternativen bleiben wie auch im Drama Hölle Weg Erde (1919) typisch expressionistisch vage. Unter dem Aspekt der Bedeutung des „lieben Gelds“ wäre interessant gewesen ein kurzes Eingehen auf Kaisers Drama Nebeneinander. Volksstück 1923, das schon im Untertitel auf den Höhepunkt der inflationären Geldentwertung im Jahr 1923 anspielt.
Sehr konkret, realistisch, allerdings ohne theoretische oder parteiliche Ausrichtung geht Hans Fallada in seinem Erfolgsroman Kleiner Mann – was nun? (1932) auf die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der Rekordarbeitslosigkeit ein, von denen vor allem der neue Stand (wohl nicht eine „Klasse“ – S. 188) der Angestellten betroffen war. Da ließen sich Parallelen bei Ödön von Horváth, etwa in seiner Komödie Zur schönen Aussicht (1926/27) oder in seinen Volksstücken wie Kasimir und Karoline (1932) finden, in denen die vor allem Beziehungen steuernde Rolle des „lieben Geldes“ explizit thematisiert wird. Sehr direkt spricht – dem eigenen Postulat bei der Pariser Exilkonferenz von 1935 folgend (vgl. S. 202) – Bertolt Brecht in seinem einzigen Volksstück Herr Puntila und sein Knecht Matti (1940) die „Eigentumsverhältnisse“ (ebda) in der kapitalistisch organisierten Gesellschaft, zugleich die Herr-Knecht-Dialektik an. Als Verfechter einer operativen Ästhetik genießt er die größte Wertschätzung des Verfassers.
Von der Literatur nach 1945 greift Hermand beispielhaft drei Autoren der DDR und vier der BRD heraus. Heiner Müllers Drama Der Lohndrücker (1957) wendet sich wider klischeehafte Parolen der SED, vor allem auch gegen die vom Programm des Sozialistischen Realismus geforderte Zeichnung eines „positiven Helden“ (S. 230). Vielmehr wird sehr korrekt die negative Stimmung innerhalb der Arbeiterschaft erfasst, die zwar nicht unter kapitalistischen Prinzipien leidet, wohl aber unter einer anderen Form der Ausbeutung. Nichtsdestoweniger tritt Müller entschieden für eine Weiterentwicklung des Sozialismus ein wie auch Volker Braun, der deprimiert ist ob des Anschlusses der DDR an den kapitalistischen Westen nach der Wende von 1989 und im Gedicht Mein Eigentum (1990) die Folgen eben dieses Anschlusses für die Besitzverhältnisse thematisiert. Problematische Eigentumsverhältnisse und die fragwürdige ökonomische Entwicklung thematisiert auch der als „unbestechlicher Chronist“ (S. 296) auftretende, ideologisch weniger fixierte Christoph Hein, vornehmlich in dem vielschichtigen Roman Landnahme (2004).
Der Fokus der Sympathie liegt in Hermands Ausführungen bei Autoren wie Brecht, mit Einschränkungen auch bei den genannten Autoren der ehemaligen DDR. Nicht ohne Wertschätzung bewertet der Verfasser die kritische Position, die Martin Walser in seinem Roman Ehen in Philippsburg (1957) gegenüber Wirtschaftswunderblindheit, Konsumismus und medialen Manipulationsstrategien durch „Dienstleistungsjournalisten“ (S. 248) einnimmt. Höchste Anerkennung wird Günter Wallraffs Industriereportagen gezollt, wie denen unter dem Titel Ihr da oben – wir da unten (1973, gemeinsam mit Bernd Engelmann). Wallraff, Bestrebungen der Gruppe 61 beziehungsweise der Arbeitskreise Literatur der Arbeitswelt weiterführend, ergreift entschieden Partei für die Ausgebeuteten. Demgegenüber stehen Texte wie Mathias Schebens Roman Konzern 2003 oder Ernst-Wilhelm Händlers Roman Wenn wir sterben (2002), in denen es um die New Economy in ihren Auswirkungen nicht auf die kleinen Angestellten und Arbeiter, vielmehr um Manager geht, die übertriebenem Leistungsdenken verpflichtet sind und unter „totaler Kontrolle“ (nach S. 275) stehen. Schebens in einem Wirtschaftsverlag erschienenes Buch ist geprägt von „konservativ-katholische[r]“ sowie „konservativ-technokratische[r] Gesinnung“ (S. 280). Händler, promovierter Betriebs- und Volkswirtschaftler, thematisiert zwar die Problematik des kapitalistischen Wirtschaftssystems, zweifelt aber – systemtheoretisch denkend – an der Möglichkeit einer systemübergreifenden Veränderung der Einkommens- und Besitzverhältnisse. Mit diesem Roman entlässt Hermand seine Leser demnach mit der für die Gegenwart wenig positiven Darstellung „systemverhafteten Lebens“ ohne „Sinnstiftendes“ (S. 315).
Das vorliegende Buch gibt einen guten Überblick über die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in ihrem Niederschlag in der Literatur. Naturgemäß ließen sich zahlreiche Autoren und Autorinnen nennen, die Einkommens- und Besitzverhältnisse thematisieren. Man denke etwa an Gottfried Kellers Roman Der grüne Heinrich (1854/5), an Johann Nestroy, der in der Posse Nur keck (1856) explizit vom „categorischen Imperativ des Geldes“ (Sämtliche Werke. Hist.-krit. Ausgabe, Bd 34, S. 49) spricht, an den schon erwähnten Ödön von Horváth oder auch an Elfriede Jelineks „bühnenessay“ reinGold (2013). Aber nicht, dass der eine oder die andere fehlt, empfindet man als Manko, vielmehr das totale Ausblenden der je mehr oder weniger unterschiedlichen Verhältnisse und ihrer Auswirkungen auf die Literatur in der Schweiz und Österreich.