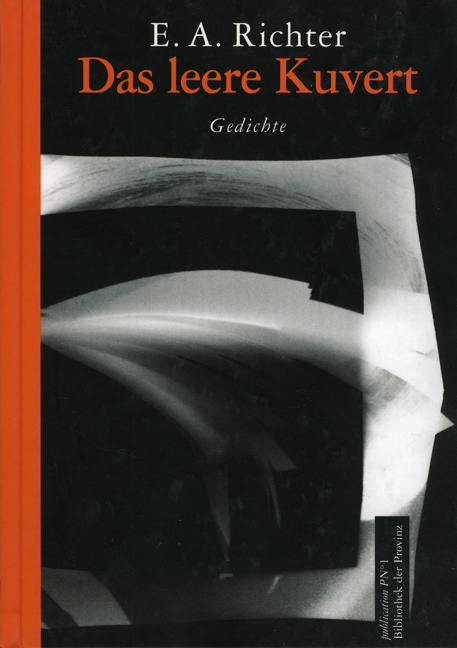E. A. Richter scheint mit Das leere Kuvert angetreten zu sein, der genannten Anschauung zu antworten: Aus dem Stoff für einen guten Essay macht er einen ebenso guten Gedichteband. Wohlgemerkt: Einen ganzen Band, der sich, wie im Nachwort Wendelin Schmidt-Dengler treffend festhält, am besten „von vorne nach hinten“ liest. Denn die Einzelgedichte dieses ganzen Bandes stoßen schnell an ihre Grenzen, wo man ihnen das „Hermetische“ abverlangt, das man sonst vorzufinden gewohnt ist, wo der vers libre regiert: Wie die Stimme eines Kommentators von weit her schalten sich da, vor allem in den ersten beiden „Kapiteln“, immer wieder „überzählige“ und pejorativ gefärbte Wendungen dazwischen, die in Bezug auf das ganze Buch sehr wohl Sinn gewinnen, so aber, nämlich als Teil des einzelnen Gedichtes, nur den Sachverhalt, den der jeweilige Text uns hauchzart umschreibt, fast karikaturhaft mit dicken Strichen in ein „Gefühlskasterl“ bannen (die Rede ist etwa von „schimmerndes Hausfrauengefängnis“). Ob dieses Stilmittel aber einen Bruch bedeute mit der Intention der Arbeit, oder ob es im Gegenteil integraler Bestandteil des Fragenkomplexes rund um das „leere Kuvert“ sei, eine Provokation durch Konkretion des lyrisch nur Angedeuteten, ist letztlich wohl Geschmackssache, mithin abhängig von der Bereitschaft des Lesers, zuzulassen, daß ihm da von Gedichten eine ganz greifbare Geschichte aufgetischt wird: Kennen wir ja etwa in der klassischen ostasiatischen Lyrik solche Rückversicherung einer „konkreten Handlung“, aus der das Gedicht destilliert wird, als etwas nahezu Verpflichtendes.
Eine Berechtigung zieht solch dicker Farbauftrag mitten in den Gefilden ansonsten durchscheinend-halbgreifbarer Bilder aus der Rückbesinnung auf die Wurzeln der Lyrik in der Musik, die gerade dort ironisch zwinkernd Platz greift, wo man es nie und nimmer erwartet hätte: Denkbar unmusikalisch muten die Zeilen „Blut pumpt mich durch Orte und Zeiten / Eklatantes baut sich rundherum auf / Blut kehrt in sich selbst zurück.“ selbst in Anbetracht des Rütt-Muss (Arno Schmidt) der dritten Zeile an, aber dennoch strukturieren sie das Gedicht „Blutkreislauf“ als Kehrvers, verbinden die Bilder, die da, gleichsam Partikel in Schlagadern, vorbeigepresst werden.
Zum erwähnten Essay-Stoff: Ein Bekenntnisbuch im besten Sinne liegt vor: Eine Jugend wird geschildert, in wohldurchdachter „Combray“-Manier aus der Perspektive des Schlafenden, der sein Körperbewußtsein ausdehnt auf sozusagen „alle Körper, die er war“. Der Autor mag angesichts solch grotesker Verkürzung protestieren, da die Beziehungen Körper-Kindheit-Dorf viel feinmaschiger, eben lyrischer sind, doch mir ist es nur um ein Exzerpt der prosaischen „Handlung“ zu tun. Daß seine Verse diese transzendieren, und daß darin ein guter Grund liegt, das Buch zu lesen, versteht sich für mich von selbst. Erinnerungen an Szenen in Paris, Erprobungen des noch rohen Bewußtseins, folgen. Schließlich wird dem Schläfer seine Körperlichkeit – wie überhaupt das Fundament seines Ich-Empfindens – fragwürdig. Mögliche Auswege finden sich in der – wachen – Beobachtung der „kleinen Dinge“. Immer präziser wird diese, immer ersichtlicher regiert das „sanfte Gesetz“, immer mehr nimmt sich das schwitzende, fragende, ächzende Körper-Ich zurück, einmal beseeligt, einmal den „intensiveren Erfahrungen“ nachtrauernd.
Ein Weg in die Präzision wurde uns geschildert, wenn wir beim programmatischen Schlußtext angelangt sind, „Verdünnung“, der dieselbe dem Leser-Ich als Summa der Erfahrung anbietet: „Lösch dich nicht aus, lös dich ab, / sei ganz Dünn im Raum“. Sätze wie der unmittelbar vorhergehende („Spring nicht auf, breit / dich nicht aus, bleib hier / im Papier, in deinem Schatten!“) vergällen es dem Pathos-anfälligen Leser möglicherweise, sich darauf so richtig einzulassen, was dieser „verdünnte Körper“ uns da zu sagen hat, aber wie gesagt: Über Geschmack kann man streiten.
Letzlich also: Ein Buch, das vor allem die formbewußten Lyrik-Konsumenten in Fragen über Fragen zu stürzen die Kraft hat. Ein Buch, das eindringlich vom Prozesshaften des Älterwerdens redet. Ein Buch, das all jene lieben werden, die die Lyrik des jungen Thomas Bernhard mögen. Und für die Bibliothek der Provinz ein eigentlich programmatischer Band.