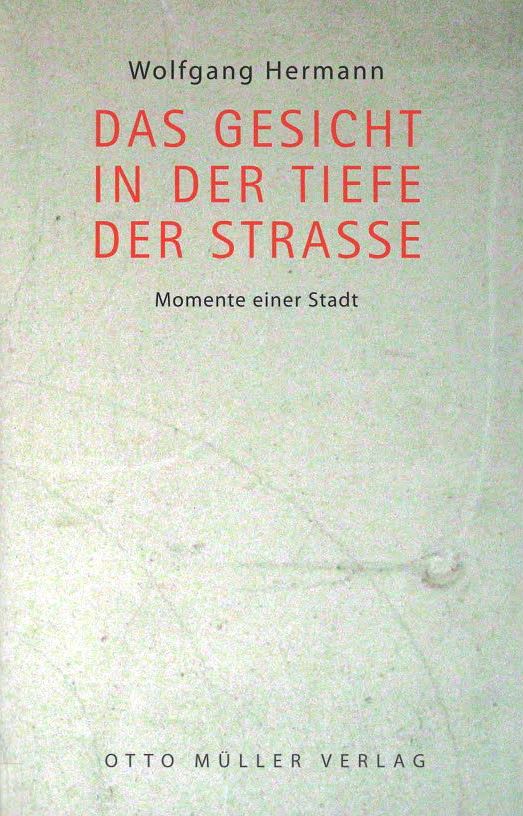Zwar ist es bei Hermann immer mehr ein Schreiben denn Sprechen, aber seit „Das schöne Leben“, seinem Buchdebüt 1988 bei Hanser, begleitet ihn das Urbane als Faszinosum, als Schreib-Urgrund. Erich Hackl brachte in einer Rezension „Das Gesicht in der Tiefe der Straße“ ungewöhnlicher-, aber konsequenterweise mit „Mein Dornbirn“ (1991) in Bezug, mit jenem „Heimatbuch“ Hermanns, das sich in einer „fast schmerzhaften Präzision von Beobachtung und Beschreibung“ (Hackl) dem Geburtsort nähert und so gar nichts mit herkömmlichen Heimatbüchern zu tun hat.
Viele Bücher Hermanns sind topographische Breviere, auch diese „Momente einer Stadt“. Das Topographische ist der Urgrund dieses Schreibens, aber nicht die alleinige Entität – die Orte werden in den kurzen Prosastücken osmotisch, die Zeit dringt in sie ein, vielfältige Sinneseindrücke sind daran gebunden oder auch Erinnerungsbilder. Hermann „beschreibt“ also keine Städte, er „erschreibt“ sich aber auch keine poetisch genuinen Städte. Schreiben ist bei diesem Autor Apperzeption, Wahrnehmung und das Hinterfragen von Wahrnehmung (und ist deshalb kein „Sprechen“). Und dabei begleitet ihn ein scheinbares „Urvertrauen“ in die präzis gesetzten Wörter, mitunter meint man es mit einem sprachlich hellwachen Traumwandler zu tun zu haben. Wolfgang Hermann hat nie Scheu vor (seinen) „großen“ Worten, er geht unbekümmert ins vermeintlich Pathetische hinein. Diesmal sind aber die urbanen Momentaufnahmen sprachlich „zurückhaltend“, sich oft dem Fotografischen annähernd – wobei es in keiner Weise um Wiedererkennbarkeit geht, die Städte sind namenlos, und wo sie – wie Paris in mehreren Fällen – erkennbar sind, sind sie nicht „typisch“.
Die Wahrnehmung wechselt zwischen Bewegung und Stillstand, zwischen Verwandlung und Bild („Wie das Bild einer Stadt sich verwandelt für den, der in es eintritt.“); Verkehrsmittel, Züge und Flugzeuge werden dabei ebenso häufig aufgesucht wie die Cafés – Orte des Stillstands im Gewühl der Großstadt. Manchmal fließt beides, Bewegung und Stillstand, zusammen, man bewegt sich in das Bild hinein.
Der Blick des Schreibenden ist stets ein fragender, er möchte am liebsten den Blick permanent reinigen. In dieser Hinterfragung wird die Stadt zum Spiegel des Selbst – und die Spiegelmotive tauchen denn auch häufig auf. Mit dem Phänomen Stadt scheint es so zu sein wie mit jenem Spiegel im Text, dem eine Frau sich nähert: „Je näher sie kommt, desto unlesbarer die Botschaft.“ Die Stadt als solche ist unlesbar („Seltsam einsame Häuser zeigen ihre unlesbaren Gesichter, er erkennt nichts wieder, vergißt, wo er ist.“), ihr ist objektiv nicht beizukommen: „Wenn ich auch alles verfügbare Material über eine Großstadt zusammentrüge, (…) so wäre doch nichts gesagt.“ Hier kann nur ein „Ich“ eingreifen mit seinem radikal subjektiven, an Momenten haftenden, detailgenauen und skizzierenden Blick – und damit etwas sagen.
Stellenweise gewinnt man aber den Eindruck, der Autor würde ein Schweigen über die Stadt vorziehen – und manche Miniaturen gehen in ihrer Kürze schon in diese Richtung. So gesehen malt Wolfgang Hermann am Ende ein äußerst konsequentes Bild (womit sich Josef Roths Tunda am Schluss der „Flucht ohne Ende“ assoziieren ließe): Die Person, „die Frau“, verschwindet in diesem Bild, sie löst sich „in der Menge auf dem Bahnsteig“ auf.