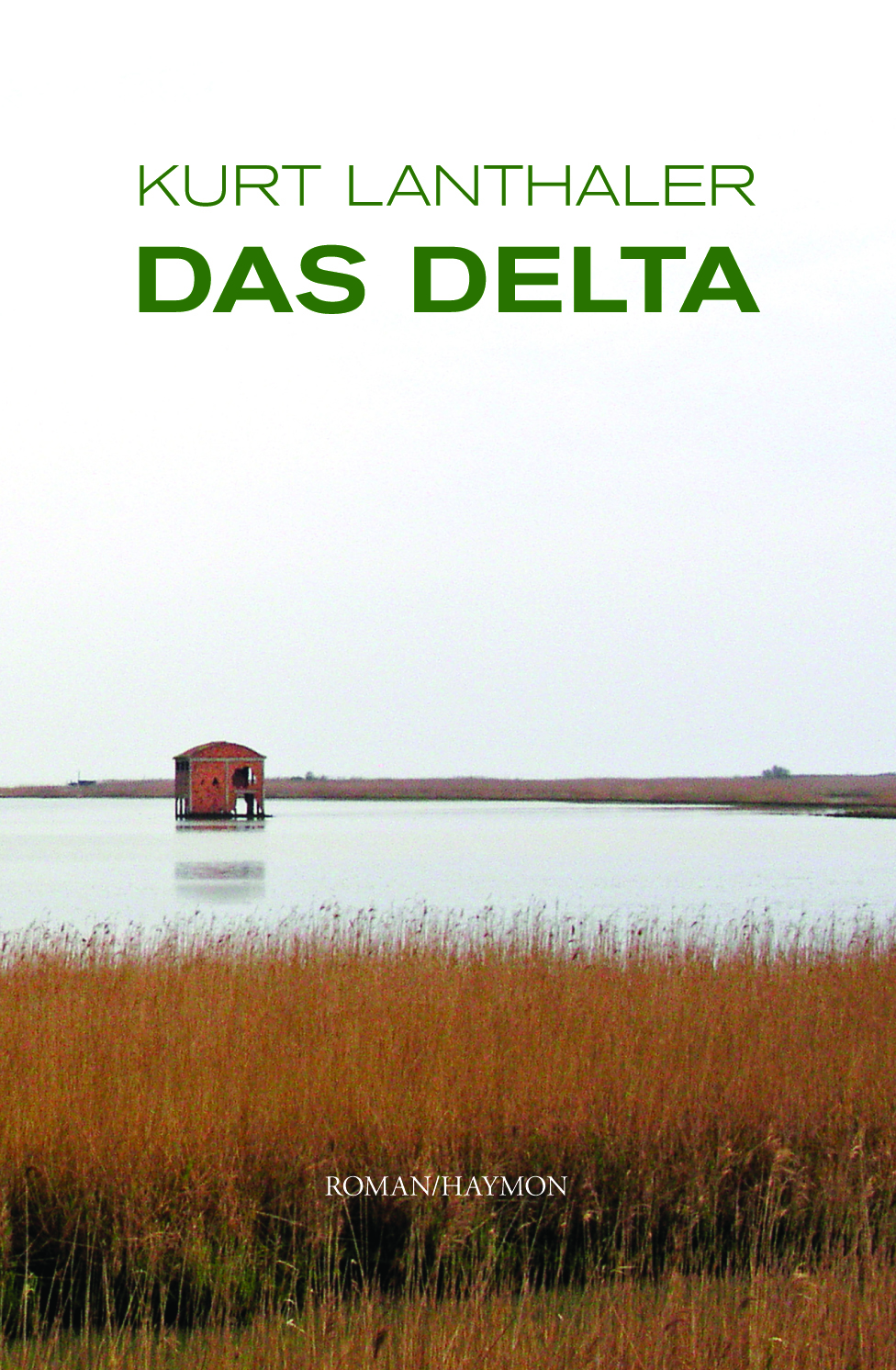Den sprechenden Namen „Fedele Conte Mamai“ erhielt, erfährt man im Laufe des neuen Romans Kurt Lanthalers, die Hauptfigur sukzessive, schrittweise. „Treu“, also Fedele, nennt ihn Bombolo, der dicke, runde und vor allem anderen schweigsame Schiffer, seitdem der Junge über Bord fiel und sich treu ans entgegengestreckte Tau klammerte. Und „Conte Mamai“ heißt der Protagonist seit einer Arbeitsepisode in einem Zirkus, als er auf ein Angebot ablehnend „Mit dir? Nie im Leben!“ antwortete, auf Italienisch „Con te, ma mai!“.
Das Delta präsentiert eine ganz außergewöhnliche Geschichte, die der heute in Berlin und Zürich lebende, in Bozen geborene Kurt Lanthaler in seinem neuen Roman erzählt. Es ist auch eine ganz außergewöhnliche Figur, die darin ihr Leben erzählt. Fedele Conte Mamai spiegelt in seinem vielfach gebrochenen, stets im Konkreten verharrenden Erinnerungsmonolog, den Lanthaler, der Schöpfer der fünf Kriminalromane um Tschonnie Tschennett, in einem sehr biegsamen, hoch melodischen, dem Umgangssprachlichen unerhört präzis abgehörten Idiom ablaufen lässt, 60 Jahre Geschichte. Jahre des Lebens im Flussdelta des Po, ausgesetzt den Naturgewalten und Überschwemmungen, kämpfend mit Armut, mit Behördenwillkür, mit Aalen und auch mit technologischen Großprojekten, die unterfinanziert sind, letztlich aber die Existenz der Alteingesessenen und ihre Kultur nachhaltig unterminieren.
Dieser Ich-Erzähler wird als Waisenkind von einem einzelgängerischen Flussschiffer aus dem Wasser gefischt, wächst bei ihm auf, entflieht als Jugendlicher dem Delta, schlägt sich als Handlanger und Arbeiter in Norditalien durch, holt dann auf einer Genueser Abendschule das Abitur nach, studiert Ingenieurwissenschaften. Doch nach zehn Jahren und zahlreichen Erfahrungen wie Ernüchterungen gibt er diesen Beruf auf für ein ruheloses, körperlich durchaus anstrengendes Leben von der Hand in den Mund, das aber innerlich erfüllend ist, mit Stationen kreuz und quer in Italien. Bevor es ihn dann schließlich doch wieder ins Delta zieht. Wo er – nach einem rasanten Zwischenspiel, als ein Polizeikommando den auf dem Bahnhof Wartenden für einen Terroristen und seinen mit Nahrung gefüllten Koffer für eine Bombe hält – ein Loblied auf den Genuss anstimmt, auf Essen und Trinken. Und so ist es alles andere als ein dramaturgischer Zufall, dass man Fedele am Ende in einer Küche stehen sieht, wo er Gemüse klein schneidet, Fleisch würfelt, ja ganze Kräuterberge klein hackt.
Das ist hinreißend in vielen, kurzen scharf skizzierten Szenen erzählt. Das ist auch deshalb so bewegend und so beeindruckend geraten, weil ein solch durch und durch menschliches Plädoyer für eine Kultur des Abseits schon lange nicht mehr zu lesen war. Vor allem nicht mit einer solch sinnlichen Sprachmacht, einem solchen Sensus für Rhythmus, Beschleunigung und Musikalität, mit einem solchen Reichtum an lustvoll linguistischen Variationen. Der Schriftsteller Hermann Burger gewann 1985 mit der Erzählung „Die Wasserfallfinsternis von Badgastein“ den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Die Prosa des Autors aus dem Schweizer Kanton Aargau war mit beeindruckender Raffinesse aufs Akustische, auf die Funktion des Vorgelesenwerdens hin geschrieben. Auch Kurt Lanthalers Roman dürfte mit seiner Oralität, seiner Funken schlagenden Wendigkeit, seinen wie mit dem Ohr gemeißelten Sätzen als Rezitation eine ebenso imposante, durchschlagende und betörende Wirkung bei seinem Publikum erzielen. Und es ins Staunen bringen. Für die Veranstalter einer „Delta“-Lesung dürfte eine anschließende Bewirtung Pflicht sein, selbstredend mit Baccalà und Babà, mit Bresáola und Bottárga.