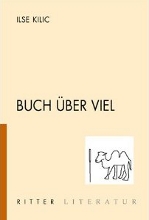Eruptiv, um bei dem Lava-Bild zu bleiben, ist das Buch über viel allemal. Denn wie in einer Geysirlandschaft führt Kilics Fährte über trockenen, spröden Untergrund vorbei an zischenden heißen Quellen, und überall hängt Schwefeldampf in der Luft, der den Ausblick auf das Folgende verwehrt. Doch hie und da brodelt das Gestein noch sämig aus dem Boden und überrascht das innere wie auch äußere Auge wie ein zähflüssiger, Gefahr bedeutender Gedanke, der erst nach und nach erstarrt. – Als „Patchwork“ hat der Verlag Kilics Arbeit kategorisiert und beschreibt den formalen Aufbau damit auch sehr gut.
Doch darf man die Konstruktion als Triptychon nicht aus den Augen lassen. Im ersten Teil folgen auf Gedanken Anekdoten, Gedichte (zu nennen ist hier Rolf Schwendters Katertotenlied, S. 32), Zitate und wiederum kurze Erzählungen wie auch Erinnerungen oder Auszüge aus Telefonaten mit befreundeten Schriftstellern zu Allerweltthemen sowie ganz persönliche Empfindungen in einer fast kindlich naiven, aber genau daraus ihre poetische Wucht generierenden Prosasprache. Dem Haupttext folgt stets eine Randnotiz, die als Stimme aus dem Off gelesen werden kann und inhaltlich mit demselben verwoben ist, aufgebrochen von skurrilen Zeichnungen, die durchaus der Art brut zugerechnet werden können (hier sei ein Verweis auf das von Ilse Kilic und Fritz Widhalm gemeinsam betriebene Glücksschweinmuseum in der Florianigasse, Wien 8, erlaubt, das auch eine Sammlung von Kilics Bildern beherbergt). Im zweiten Teil übernehmen Comics in Gestalt von Schriftbildern die Hauptrolle, auf jeder Seite eines, begleitet von einem durchgehenden Subtext. „Wir lehnen an der Wirklichkeit wie ein Fahrrad an der Wand“ (S. 79). Dieser im Telegrammstil gebaute Zwischentext beschließt auch diesen Teil mit einem „Fazit: Das ,Buch über viel‘ möchte die Welt ein bisschen weniger traurig machen und darauf hinweisen, dass die Welt darauf wartet, besser gemacht zu werden, wenngleich sie auch mit ein paar garstigen und recht unveränderbar wirkenden Naturgesetzen ihre Aufwartung macht. (…) Der Rest des Satzes geht in Protesten des Buches unter, das dagegen protestiert, dass sich seine Autorin, also ich, zu viel für das Buch vornimmt.“ Wahrlich viel mag sich die Autorin auch vorgenommen haben, der Rezeption tut dies jedoch keinen Abbruch. Denn sie hat sich für einen passenden formalen Rahmen entschieden – der dritte Teil ist gleich wie der erste aufgebaut –, in dem sie tun und lassen kann, was sie will. Es ist ja auch dezidiert kein Buch über alles. Hat man sich in dem bunten literarischen Treiben erst einmal zurechtgefunden, will man immer mehr, will man eben auch viel.
Diesem Anspruch wird Ilse Kilic in dem vorliegenden Werk weit mehr als gerecht. Denn inhaltlich thematisiert die Autorin nicht nur ihr literarisches Leben, sondern ebenso Fragen nach dem Urvertrauen, das Verständnis des Begriffs von Natur, das Schreiben selbst und nicht zuletzt ihre schwere Erkrankung, ohne dabei je in Wehmut zu verfallen. Sie geht dabei direkt ihren Ängsten nach und tut dies stets mit dem ihr so eigenen analytischen, trockenen Humor. „Ich wäre nicht ich ohne meine Angst. Sie weist darauf hin, dass das Leben ein Ende hat. Ich habe sie mit vielen Menschen gemeinsam und spiele Flöte“, heißt es da in der Randnotiz auf S. 21, wohingegen im Haupttext die Selbstdefinition des modernen Menschen hinterfragt wird. Dergestalt wechselt Ilse Kilic geysirartig die Themen, deutet hier etwas an, führt dies dort wieder fort und überrascht in jedem Fall mit neuen Perspektiven, von wo aus man das Leben noch erfrischend anders lesen kann. An Authentizität und Wahrhaftigkeit mangelt es diesem Buch über viel nicht, viel mehr gebiert es Absatz für Absatz und Seite für Seite den einen oder anderen Erkenntnisgewinn, auch wenn damit noch lange nicht alles gesagt ist. Ein Buch über alles wäre wahrscheinlich auch nicht zu ertragen.