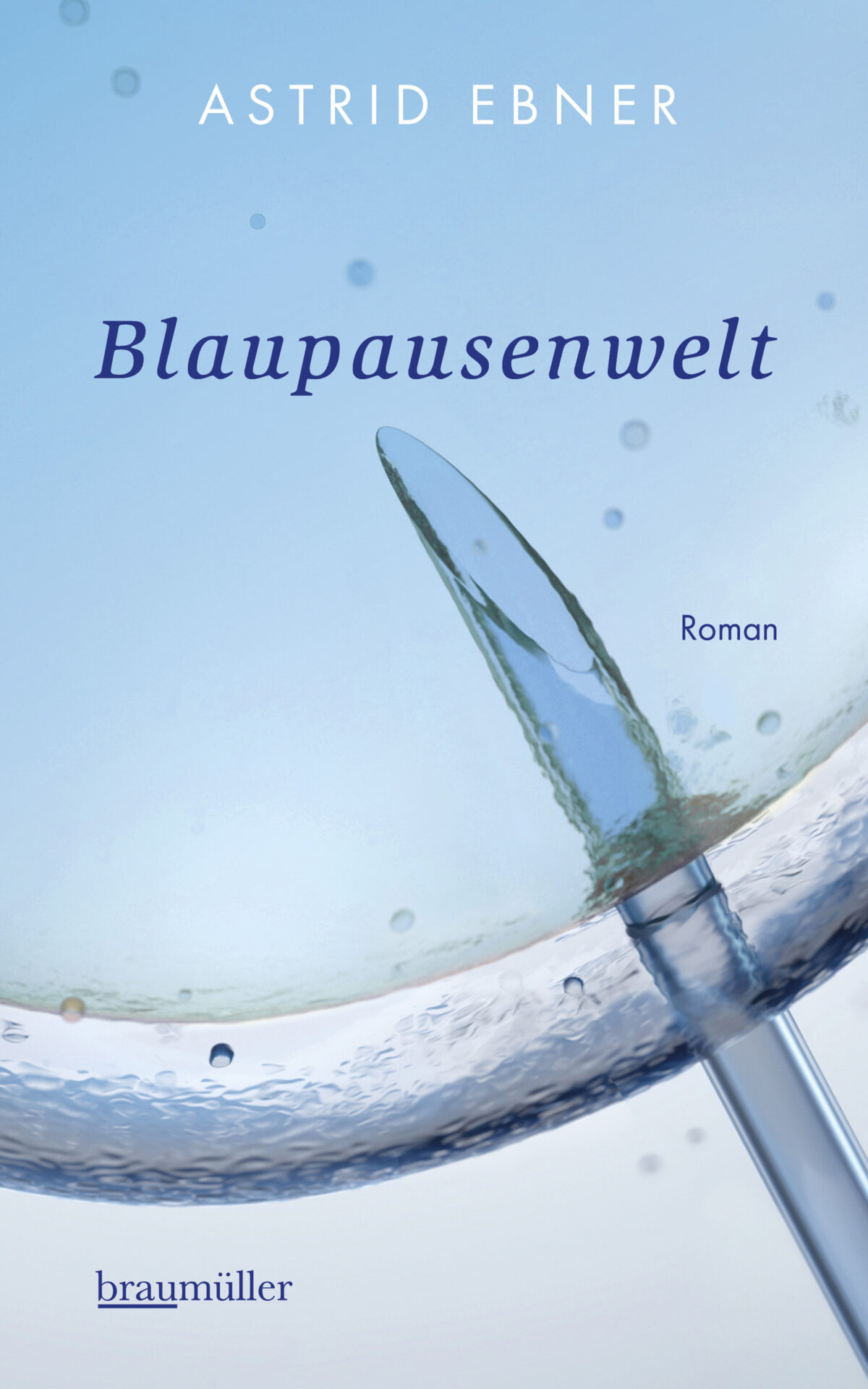Das könnte daran liegen, dass in den letzten zehn bis zwanzig Jahren in den Medien dem Privaten und oft allzu Privaten mehr Raum zugestanden wird. Und die mögliche Entstehung eines Kindes ist immer mehr zu einer Frage der medizinischen Machbarkeit geworden. Das erste „Retortenbaby“, wie man damals sagte, ist exakt so alt wie die Rezensentin; in den letzten Jahrzehnten hat sich die „künstliche Befruchtung“ – darunter auch die Methode der In-vitro-Fertilisation (IV) – zu einer üblichen medizinischen Intervention entwickelt. Aufmerksamen Zeitungsleser:innen, unabhängig von ihrem Elternstatus, wird nicht entgangen sein, dass eine solche außerhalb des Körpers, quasi in der Petrischale, durchgeführte Befruchtung auch die Möglichkeit bietet, die genetische Ausstattung des Kindes zu manipulieren.
Genau hier setzt Astrid Ebner in ihrem Debütroman Blaupausenwelt an, geht aber einen entscheidenden Schritt weiter: In der Gesellschaft, in der wir uns hier befinden und die in naher Zukunft angesiedelt scheint, hat sich das „Editieren“, also die Genmanipulation, von Babys etabliert. Damit ist gemeint, dass jeder, der es sich leisten kann, die genetische Ausstattung seines Nachwuchses vor der Zeugung auswählt: weg mit den schlechten und her mit den guten Genen. Nur mittellose Menschen bekommen noch auf ganz gewöhnliche Weise Kinder, und diese sind im Vergleich zu den „editierten“ Kindern deutlich kleiner, oft auch pummeliger, auf jeden Fall aber unscheinbarer. Im Laufe der Erzählung wird klar, dass nicht nur körperliche Defekte und Erbkrankheiten, sondern auch transgenerative Traumata der Eltern und Großeltern, die diese an ihre Kinder weitergegeben haben, aus dem Genmaterial herausgeschnitten werden können. Unnötig zu erwähnen, dass das Geschlecht des Kindes sowie seine Augen- und Haarfarbe beim „Editieren“ von den Eltern ausgesucht werden können, aber das ist noch nicht alles: auch andere Merkmale wie Hautfarbe, Größe, Gesichts- und Körperform können ganz nach Wunsch der Eltern bestimmt werden.
Blaupausenwelt erzählt die Geschichte von drei heterosexuellen Paaren, die in einer Wien nicht unähnlichen Großstadt leben und die sich Gedanken über das „Gestalten“ von Kindern machen oder bereits diesen Prozess begonnen haben: Der Literaturübersetzer Janes, ein allzu empfindlicher junger Mann, hadert mit einem englischsprachigen Text, den er übersetzen soll und dem darin beschriebenen Vater-Sohn-Konflikt. Seine Freundin Mara, Angestellte bei einer wohltätigen Organisation, wünscht sich selbst keine Kinder und beobachtet bei ihren Kolleginnen, wie schwierig ein Leben mit Kindern sein kann. Susanne und Hanno wiederum, beide um die vierzig, sind gerade dabei, ihr Wunschkind zu editieren. Der Kinderwunsch geht in diesem Fall ganz klar von Hanno aus. Er ist so stolz, bald Vater einer „genetisch gut aufgestellten“ Tochter zu werden, dass ihm ein mögliches Scheitern dieses Projekts gar nicht in den Sinn kommt. Nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Hanno Schriftsteller ist und sein Talent, Geschichten zu erfinden, sich vor allem in Heldenfantasien über seinen Vater, den er nie gesehen hat, zeigt. Seine Frau, in beruflicher Hinsicht bodenständiger (sie arbeitet in einem Laden für genmanipulierte Pflanzen), erweist sich in dieser heiklen Kinder-Editions-Angelegenheit als die realistischere und resilientere der beiden.
Und schließlich ist da noch das junge, hippe und äußerst attraktive Vlogger-Paar Bret und Lilly. Die beiden fotogenen und sehr kommunikativen etwa 30-Jährigen haben sich dazu entschlossen, das ihr Baby die mitteleuropäischen Züge seiner blonden und blauäugigen Eltern behalten aber dunkle Haut bekommen soll – als Zeichen der Vereinigung aller Völker. Lillys und Brets Baby-Projekt wird ab der Einsetzung der befruchteten Eizelle bis einige Tage nach der Geburt in bester Vlogger-Manier ständig mit dem Handy mitgefilmt und auf dem millionenfach besuchten Social Media Kanal gepostet. Selbstverständlich soll der Junge (sein Geschlecht ist in diesem Fall reiner Zufall) auch einen absolut internationalen, ja globalen Namen tragen: Mit Hilfe der Follower entscheiden sich die jungen Eltern für „One“.
Die (Alb)träume von Mara und Janes sind der Schauplatz einer zweiten, wahrhaft entsetzlichen Handlungsebene des Romans. Es sind die Erlebnisse von Janes‘ Großvater und Maras Großmutter in einem totalitären Regime, das an das Nationalsozialistische Terrorregime und die Verfolgung und Ermordung jüdischer Menschen gemahnt, und wo Janes Familie zu den Verfolgten und Maras Familie zu den willigen Mittätern und Verfolgern (Maras Großvater) oder Mitläufern (Maras damals schwangere Großmutter) zählten. Diese Szenen gehören zu den stärksten des ganzen Romans, dem es auch sonst an Eindringlichkeit nicht mangelt: Geschildert wird unmissverständlich eine Art Pogrom, bei dem die Verfolgten – egal, ob Männer, Frauen, Kinder oder Alte – in allen Ecken eines Dorfes oder einer Kleinstadt gesucht, gefunden, herausgezerrt und erschossen und deren Wohltäter brutal betraft werden. Hochproblematisch an diesen Romanpassagen – oder stilistisch und erzählerisch unnötig – ist, dass für die Verfolgten als Codewort Tiernamen („Ratten“, „Enten“, „Hasen“ …) verwendet werden, denn in diesen erschreckend authentisch erzählten Szenen sind die Traumata von Verfolgung und die Schuld von Janes‘ und Maras Vorfahren derart deutlich geschildert, dass hier jegliche Verfremdung überflüssig ist.
Alles ändert sich allerdings für Janes und Mara, als sie von einer Studie erfahren, die die Entfernung transgenerativer Traumata aus dem Genpool künftiger Kinder verspricht. Susanne entscheidet sich spontan für eine ganz andere Lösung für ihren und Hannos Kinderwunsch. Und auch im Leben von Bret und Lilly entwickeln sich die Dinge nicht wie geplant …
Blaupausenwelt ist eine rasante Erzählung darüber, wie Fortpflanzung in nicht allzu ferner Zukunft aussehen könnte. Dabei bewegt sich der Text stellenweise an der Grenze zur Science-Fiction, was ihm einen phantastischen Touch verleiht, wobei die Geschichte diese Details gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Zudem zieht der Roman an seinen weniger düsteren Stellen gewisse Auswüchse unserer hochmodernen Gesellschaft gekonnt durch den Kakao: Die pathetische Aufladung von Mutter- und Vaterschaft, die symbolische Überfrachtung des Kind-Themas, die geschwätzige Selbstbespiegelung und -ausstellung von Blogger:innen. Der Bucherstling von Astrid Ebner, die u. a. Germanistik, Philosophie und Psychologie in Graz sowie Literarisches Schreiben am Literaturinstitut in Hildesheim (D) und an der UdK Berlin studierte, ist eine über weite Strecken eine sehr überzeugende Bearbeitung der Frage, wie wir in naher Zukunft mit Fortpflanzung und den verfügbaren Reproduktionsmöglichkeiten umgehen wollen, als Einzelne und als Gesellschaft.
Jelena Dabić, geb. 1978 in Sarajevo, studierte Germanistik und Russistik in Innsbruck und Wien. Übersetzerin aus dem Serbischen, Kroatischen und Bosnischen, Literaturkritikerin und Sprachlehrerin. Zuletzt erschienen in ihrer Übersetzung: 24 von Marija Pavlović (Roman, Drava, Klagenfurt 2021), Die schwindende Stadt von Pavle Goranović (Gedichte, edition korrespondenzen, Wien 2019) und Grüne Nacht in Babylon von Sofija Živković (Gedichte, Edition Aramo, Wien 2018). Teilnahme am 23. Poesiefestival Berlin (Juni 2022). Mitarbeit an den Anthologien Grand Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas. Hg. von Federico Italiano und Jan Wagner (Hanser 2019) und VERSschmuggel. Poesie aus Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro […] (Das Wunderhorn, Heidelberg 2023). Rezensentin beim Portal poesiegalerie. https://www.poesiegalerie.at/wordpress/