Der gelernte Elektroinstallateur Harald Darer ist hier eine Ausnahme. Geboren 1975 in Mürzzuschlag, ist er gut dreißig Jahre jünger als Wolfgruber und zeigt in seinem neuen Roman Blaumann eine Kontinuität auf, die man lieber nicht wahr haben möchte. Sein Elektrikerlehrling erfährt noch Ende der 1980er Jahre die brutalen Implikationen des „Herrenjahre“-Sagers am eigenen Leib, samt den dazugehörigen Rohheiten, der rabiaten Willkür des Chefs und jeder Menge missbräuchlicher Beschäftigungen. Sicher, wir befinden uns in der sogenannten „Provinz“ – aber eben nicht mehr in den dunklen Nachkriegsjahren.
Bei Lehrantritt kam der Erzähler damals, von seiner Mutter auf Servilität als notwendige Grundausstattung des Arbeiters getrimmt, eine „Dreiviertelstunde vor Arbeitsbeginn“, und siehe da, auch der zweite Lehrling ist schon in Warteposition. Allerdings stehen sie gemeinsam am falschen Eingang der Firma „Elektrogeiger“, was den sorgfältig geplanten Einstand gründlich vermasselt.
Der Erzähler hatte dann, nennen wir es Pech. Während sein Kollege und späterer Freund Frank Sonnenschein vom ersten Tag an mit auf Montage genommen wird und also abgesehen von den rauhen Sitten zumindest auch etwas Berufsrelevantes lernt, ist er vor Ort zuständig für alles Grobe: Holzhacken, Gartenarbeiten oder große Posten Leuchtstoffröhren zerschlagen, um die hohen Entsorgungskosten zu sparen. Doch, man wusste auch damals schon um die hochgiftigen Dämpfe, die dabei frei werden – sonst wäre die Entsorgung ja nicht so teuer gewesen –, aber die Gesundheit eines Lehrlings spielte keine Rolle.
Der allererste Arbeitseinsatz am ersten Lehrtag aber hat besonders fatale Folgen. Der Juniorchef fordert ihn völlig ansatzlos auf, eine 150 Kilo schwere Waschmaschine in die „Weißwaren“-Abteilung zu schleppen. Daraus wird nicht nur der „Startschuss eines lebenslangen Unterleibleidens“ und wenig später eine erste Operation, der Erzähler hat auch etwas gelernt, nämlich das Wort „Weißware“. Das aber sagt ihm einiges über die Gesellschaft, etwa „dass die Sprache in der Arbeitswelt mit der Sprache in der Privatwelt und der der Schulwelt nichts zu tun hat, wird sie einem vor allem in der Schulwelt im Gegenteil mit Gewalt verheimlicht, scheint es seit Jahrzehnten in den Lehrplänen fest verankert zu sein, die Schüler von der Arbeitswelt und der Arbeitsweltsprache so gut wie möglich abzuschirmen und sie totzuschweigen, deshalb war es nur natürlich, dass die Arbeitsweltsprache für jeden Neuankömmling in der Arbeitswelt eine Fremdsprache war, bestehend aus Codes, Allerweltsweisheiten und Sprüchen.“ Und so lautet einer der ironischen Lehrsätze, die Darer immer wieder einfügt: „Das Gewaltsthermometer zeigt bei Selbstausbeutung am Arbeitslatz immer hundert Grad an. … Sinn macht nur, was krank macht.“
Bei den bislang erschienenen vier Romanen Harald Darers wurde immer wieder auf zwei Autoren verwiesen: Thomas Bernhard und Franz Innerhofer. Beides hat durchaus seine Berechtigung. Passagen – wie die hier zitierte – füllen den Bernhard-Sound mit ganz anderen Inhalten, während ein Roman mit dem Titel Blaumann insgesamt anschreibt gegen die von Innerhofer angeprangerte „Arbeiterverschweigkultur“.
Und man könnte noch eine dritte literarische Spur verfolgen. Der Vater des Erzählers, dessen „Kelomat-Charakter“ immer wieder zu peinlichen Auftritten und wohl auch heimischen Gewaltausbrüchen führt, hat ein Leben lang im „Werk“ gearbeitet, das alles verschlingt: die Arbeiter, die Väter, die Toten. „Das Werk muss ein Ungeheuer sein, habe ich mir gedacht, und der dortige Portier war die Zunge dieses Ungeheuers, sein Sprachrohr, das meistens mitten in der Nacht angerufen hat um meinen Vater aus dem Bett und ins Werk hineinzuholen. … Seitdem habe ich jede Nacht vor dem Schlafengehen Angst gehabt, das Werk könnte ihn womöglich eines Tages nicht mehr herauslassen, nachdem es ihn wieder einmal hineingeholt hat in der Nacht, und, was die noch größere Angst war, wann wohl das Werk anrufen würde, um mich hineinzuholen“.
Ist bei Elfriede Jelinek der Heimatboden von den Untoten der Zeitgeschichte zu ewigem Brodeln verdammt, schreibt Darer diesem Schuld-Kreislauf die Arbeitergeschichte ein. „Die Knochen der Arbeiter sind das Fundament der Werkshalle“, sagte sein Vater, und sie „kommen leider aus ihrer Arbeiterhaut nicht heraus, aus ihrer Arbeitermonturhaut“.
Was der Vater damit meint, versteht der Sohn erst, als er selbst in die Arbeitswelt eintritt. „Mein ganzes bisheriges Leben hatte ich das Gefühl gehabt, mein Vater verheimliche etwas vor mir, ein grundlegendes Wissen darüber, wie die Dinge so liefen und warum sie so liefen.“ Nun weiß er es.
In Gang kommt der Erzählprozess, weil sich die beiden Lehrlinge einst geschworen haben, einander genau 25 Jahre später vor dem Portal von „Elektrogeiger“ wieder zu treffen. Sie haben lange Kontakt gehalten, aber sich dann doch aus den Augen verloren. Der Freund tourte auf Montage durch die Welt, während der Erzähler in der Region geblieben ist. Und so wartet er nun – vergeblich – am Ort ihrer gemeinsamen Leidensjahre, bzw. bald im nahen Stehbeisel. Alle Erinnerungen kommen wieder hoch, während er allmählich mit einem etwas derangierten „Kollegen“ ins Gespräch kommt, der behauptet, „aus freien Stücken zum sozialen Ausgedinge“ der „freiwillig Arbeitslosen“ zu gehören.
Mit steigendem Alkoholspiegel der beiden Männer gerät im zweiten Teil des Buches auch die Handlung etwas außer Kontrolle und kippt ins Schräge – keineswegs ins Unrealistische, vielmehr bleibt sie auf „das Werk“ bezogen und verrät einiges über das Dahinter der flotten Erzählungen des Stehtisch-„Kollegen“. Auch bei der Lebensgeschichte des Erzählers bleibt manches im Unklaren – nur der Schlusspunkt der Geschichte ist klar und rundet den Roman ironisch ab. Davon nur soviel: die beiden Freunde begegnen einander nicht, aber der Erzähler weiß am Ende, dass der andere die Zigarettenmarke nicht gewechselt hat.
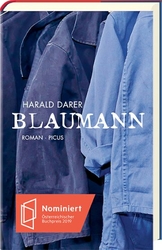
Blaumann
// Rezension von Ulrike Diethardt; Evelyne Polt-Heinzl
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“. Das beschrieb Gernot Wolfgruber 1976 in seinem Roman Herrenjahre recht drastisch. Es war eine Zeit, in der sich Literatur für die unspektakulären Schicksale der sogenannten kleinen Leute interessierte. Solche Phasen sind in der Regel kurz, denn eigentlich gelten diese Themen nicht als literaturfähig. Dass wir selten zu lesen bekommen, wie es in den Werkhallen und Werkstätten so zugeht, hat freilich auch damit zu tun, dass Autorinnen und Autoren dort selten beheimatet sind. Eher schon an den Universitäten und Schreibakademien.
Harald Darer Blaumann
Roman.
Wien: Picus, 2019.
190 S.; geb.
ISBN 978-3-7117-2075-7.
Rezension vom 23.09.2019
Originalbeitrag. Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser:innen verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.