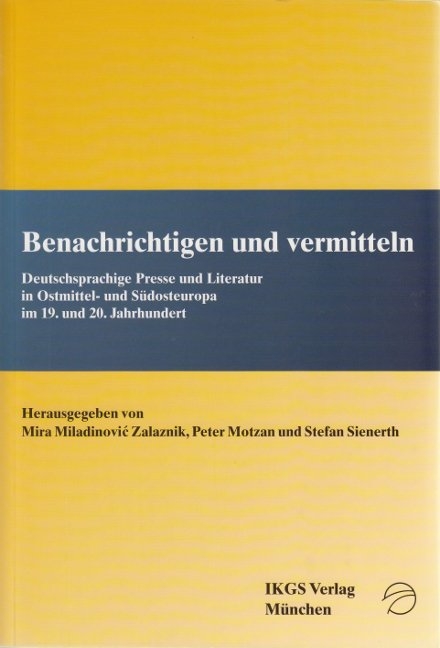Zudem gilt von diesem Sammelband wie von wenigen Büchern dieser Art: Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Selbst der eine oder andere oberflächlichere Beitrag ist doch ein Beitrag zum Gesamtbild einer Presselandschaft, genauer: von sehr durch Wien geprägten Presselandschaften, in denen von etwa 1800 bis 1945 die mitteleuropäische Kultur lebte. Interessant wären unter diesem Aspekt Parallelstudien zu deutschsprachigen und, beispielsweise, slowenischen oder ungarischen Medien. Noch der einzige monografisch eine Einzelperson, den in Auschwitz ermordeten Oskar Rosenfeld (* 1885) behandelnde Aufsatz fügt sich als Darstellung eines (leider) typischen Schicksals in das Gesamtbild ein. Die vorgestellten Zeitungen und Zeitschriften standen (und stehen in Rumänien und Ungarn noch) vor der Aufgabe, Bürgerinnen und Bürger deutscher Muttersprache über ihre anderssprachige Umwelt zu informieren, zwischen dieser und der muttersprachlichen Kultur zu vermitteln und Bindungen an den deutschen Sprachraum zu erhalten oder zu verstärken. Manche dieser Organe wollten darüber hinaus Deutsch Lesende über den Raum informieren, in dem die Autoren lebten, als beispielsweise Deutsch schreibende „gute Ungarn“ (z. B. 419f.).
Obwohl der Beitrag von Eduard Schneider über „Literatur und Literaturreflexion“ in der Temeswarer Neuen Banater Zeitung (1969 bis 1975), mit vielen Informationen zur für die gesamte deutsche Literatur wichtigen Aktionsgruppe Banat, im engeren Sinn nicht viel mit der Literatur Österreichs zu tun hat, möchte ich ihn ausdrücklich erwähnen, zeigt er doch exemplarisch, wie Medien Literatur anregen und fördern können. Den bibliografischen Teil des Artikels kann man unter dem Gesichtspunkt lesen, dass viele unbekannt bleibende, irgendwann aufhörende Literatinnen und Literaten die Voraussetzung dafür sind, dass einige wenige (in diesem Fall Herta Müller und Richard Wagner) den Durchbruch schaffen.
Die Rede geht hier von der Mehrsprachigkeit mancher Autoren (vgl. u. a. die Aufsätze über deutsche Blätter in Kroatien und Slowenien und den über den Pester Lloyd), von Spannungen zwischen den Sprachen und dem allmählichen Entstehen pressetauglicher Schriftsprachen, die dann das Deutsche verdrängen, von der Rezeption in Österreich und Deutschland geschriebener Literatur in fernen Provinzen. Politische Aspekte werden berücksichtigt, stehen aber nicht im Vordergrund; dass die Nationalitätenkonflikte nur abgemildert vorkommen, mag dem Wunsch entspringen, die jetzt wieder (oder erstmals) mögliche unvoreingenommene kulturelle Begegnung nicht zu belasten. Unter österreichischem Gesichtspunkt, der an dieser Stelle im Vordergrund zu stehen hat, ist das anscheinend fast vollständige, selbst Volkskalender beachtende Bild der deutschsprachigen Printmedien aus Slowenien und Kroatien von besonderem Interesse. Der Bukowina, dem zweiten Raum, den der Literatur Österreichs zuzuordnen wir gewohnt sind, sind ausführliche und fundierte Beiträge über drei wichtige Medien (Die Gemeinschaft; Czernowitzer Tagblatt; Bukowinaer Provinzbote) der Zwischenkriegszeit gewidmet. Interessant – zumal in Hinblick auf die zumeist angenommene Österreich-Orientierung der Bukowina – die geringe Zahl von Namen aus Österreich unter den in der Gemeinschaft vorgestellten Autoren (217). Auf Einzelheiten kann ich nicht eingehen.
Insgesamt bietet der Band (an dem kein Österreicher mitgearbeitet hat) Grundlagen für weitere Forschungen über die Einbettung der Literatur Österreichs in den vielsprachigen Raum des Habsburgerstaats. Dass einzelne Beiträge zu viel Vertrautheit mit dem Umfeld beispielsweise Rumäniens voraussetzen und dass vereinzelt sprachliche Schlampereien (keineswegs nur oder vorwiegend in den Beiträgen Nicht-Deutschsprachiger) stehen geblieben sind, tut der Qualität dieses Panoramas der deutschsprachigen Presse in unseren östlichen und südöstlichen Nachbarländern keinen Abbruch. Das Buch bietet Grundlagenforschung zur Literaturgeschichte (auch) Österreichs.