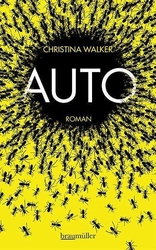Vom Auto aus hat Busch die Fenster seiner Wohnung im Blick. Dort oben wohnen Susanne und Matti, seine Frau und sein Sohn. Matti kommuniziert morgens mit seinem Vater, indem er auf die vom heißen Duschwasser beschlagenen Fensterscheiben Strichmännchen malt. Der Zehnjährige ist dabei, eine eigene Sprache für den verlorengegangenen Vater zu entwickeln. Susanne kommuniziert dagegen mit diffizileren Zeichen: einer stehengelassenen Espressotasse, einer offenen oder geschlossenen Schlafzimmertür. Was anfangs nach einer kurzlebigen Marotte des Ehemanns und Familienvaters klingt, wächst sich zu einem stillen Drama aus.
In Rückblenden erfahren wir, dass Busch ehemals im Buchvertrieb tätig gewesen ist, immer im Auto quer durch Deutschland unterwegs. Irgendwann konnte er das Autofahren nicht mehr ertragen und stieg auf die Bahn um, was seine Arbeit einigermaßen kompliziert machte. Die Wege wurden länger, die Zeit wurde knapper.
Für Herrn Busch ist die Zeit „ein Schaben“ oder „ein nasses Knie“ – die Zeit ist eine genaue Wahrnehmung. Bis ins kleinste Detail gibt er sich dem Schauen, Wahrnehmen, Spüren und Beobachten hin. Lange vor dem Stillstand schon begann er Argumente gegen die Bewegung zu sammeln. Er sträubte sich gegen das Tempo und die Vorgaben, gegen den Betrieb und die Betriebsamkeit. Er kündigte und zog ins Auto, das Symbol der jederzeit verfügbaren, schnellen Fortbewegung schlechthin. Es scheint, als müsse er beweisen, dass ein solches Symbol zu vernichten ist.
In der Bewegungslosigkeit nun glaubt er, den Weg zurück zu finden, weil erst vom Stillstand die Umkehr möglich wird. Er stellt Regeln auf, die da lauten: Eigenbewegung reduzieren, Fremdbewegung (Bahn, Auto usw.) vermeiden, Sentimentalitäten kurz halten … . Herr Busch liebt seine Frau und sein Kind, aber leben kann er nicht mehr wie zuvor. Selbst als sich seine Bewegungslosigkeit ein wenig verflüchtigt, er Zugeständnisse an seine Umwelt, an seinen Hunger, an das tägliche Duschen, an immer noch vorhandene „Freunde“ (den Barkeeper Markus, den rotgetigerten Kater, den demenzkranken Nachbarn) macht – er verweigert den Wiedereinstieg in das, was gemeinhin als „Normalität“ bezeichnet wird. Es ist die Kernfrage des Romans, was überhaupt „normal“ ist.
Während die Reaktionen des Sohnes auf das ungewöhnliche Verhalten von Busch lebendig und nachvollziehbar wirken, bleibt die Figur der Ehefrau seltsam blass. In ihrer beinahe völligen Abwesenheit vermittelt sich nur ihre Engelsgeduld. Wir wissen, dass sie täglich joggt, den Sohn versorgt und zur Arbeit geht. Ihre Ausflüge zu Busch ins Auto oder mit einem Yogalehrer in die Berge bleiben ohne Konsequenz. Es gibt keine Zeichen der Verzweiflung oder des Unmuts, keine Hand, die sich hilfreich ausstreckt, keine Forderung nach Verantwortung oder einem Gespräch.
Sonst hält die Autorin jede minimale Veränderung in diesem Stillstand fest. Sie hat jeden Wassertropfen, der durch das morsche Autodach dringt, fest im Blick. Jede Regung von Buschs Körper, und sei es das rätselhafte Surren in seinem Hintern, wird notiert. Die Welt im Hinterhof ist ein detailreicher Mikrokosmos und ein Ort des stillen Kampfs, der mit subtilem Humor geschildert wird. Ameisen kämpfen um ihre Straße am Garagentor, der Frisör kämpft gegen den Gestank der Mülltonnen, der demenzkranke Nachbar kämpft gegen das Vergessen, Pokémon-Jäger kämpfen um den besten Mobilnetzempfang. Auch dass Busch für seinen Psychiater die besseren Ratschläge im Ärmel hat als dieser für ihn, gehört zu den humorvollen Überlegungen, wer und was eigentlich normal ist.
Und doch ist die Grundstimmung eine der übermächtigen Ratlosigkeit – das ändert sich auch nicht, als das Auto auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Nach der „Durchlässigkeit“ seiner Person fürchtet Busch seine „Auflösung“. Nur die feine Ironie der Autorin macht die große Traurigkeit, da die Zeit „ein tiefes Loch“ ist, erträglich. Christina Walker gibt ihrem Protagonisten bis zur letzten Seite eine Chance und lässt hoffen, dass er zu dem zurückfindet, was er liebt.