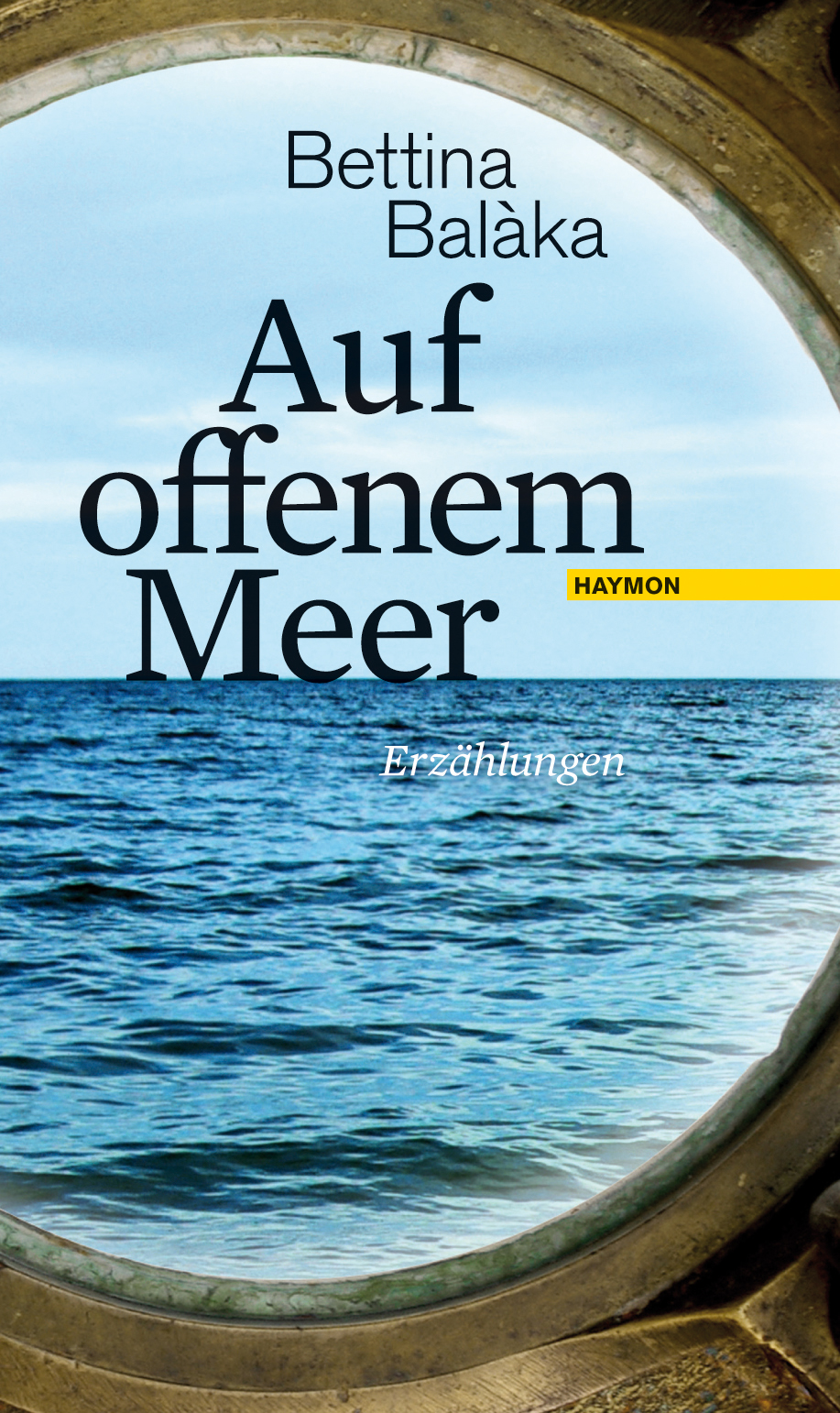Im vorliegenden Erzählband hat es sich Balàka abermals zur Aufgabe gemacht, Historie und Fiktion zu verflechten. In Titanic, der ersten und mit 40 Seiten auch umfangreichsten der sechs Erzählungen, bildet wieder ein Mann in russischer Gefangenschaft die zentrale Figur. Anders als in Eisflüstern handelt es sich hier jedoch nicht um einen feindlichen Eindringling von außen, sondern vielmehr um einen „Feind“ aus den eigenen Reihen: den berühmten Botaniker, Genetiker, Geographen und Agronomen Nikolai Iwanowitsch Wawilow. 1940 wurde dieser tatsächlich wegen „Hochverrats, Sabotage und Zerrüttung der sowjetischen Landwirtschaft“ zum Tod verurteilt.
Unser Blick auf den Gefangenen wird perspektivisch gelenkt durch den stellvertretenden Gefängnisdirektor, der namenlos bleibt. Er negiert und missachtet Wawilows Behauptung einer Genetik, geht doch der Sozialismus von der Formung des Menschen durch Erziehung aus. Der stellvertretende Gefängnisdirektor arbeitet pflichtbewusst an der Vernichtung Wawilows mit. Und handelt – in seinen eigenen Augen – gleichzeitig unmoralisch, indem er den Ausführungen des Gefangenen lauscht oder ihm ein Ei mitbringt, ein Geschenk seiner Frau an den von ihr verehrten Wissenschaftler, obwohl sie selbst kaum zu essen haben.
Diese Erzählung über einen Mann, der davon träumt, Wildkartoffel-Samen aus seiner Leningrader Sammlung in 100 Jahren wieder im Anden-Hochland ansiedeln zu lassen, besticht durch ihre kunstvolle und dabei klare Sprache, ihre gekonnten Dialoge und eine feine Psychologie. Die Leningrader Samensammlung überlebte übrigens. Teile der ausgelagerten Sammlung wurden aus der Ukraine und von der Krim ins SS-Institut für Pflanzengenetik ins Schloss Lannach bei Graz verschleppt.
Für die letzte Erzählung, Blaue Augen, dienten der Autorin Recherchen von Peter Pirker über den Widerstand in Tirol während der NS-Zeit. Auch hier spitzen sich die Probleme aufgrund einer komplizierten, ambivalenten Ausgangslage mehr und mehr zu. Das personelle Dreieck besteht aus der im Sterben liegenden Oma, der einstigen BDM-Chefin von Wien und Niederösterreich, die Adolf Hitler nach wie vor verehrt. Ihrgegenüber steht die schwangere, braunäugige Juristin Simone, deren Großvater im Krieg immer wieder über die steilen Tiroler Pässe nach Italien wanderte, um in Almhütten mit britischen Geheimdienstleuten zu konferieren. Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen und anderen war er an zahlreichen Sabotageakten beteiligt. Alle drei Widerstandskämpfer wurden erschossen. Als Bindeglied zwischen den beiden ungleichen Frauen fungiert der Ehemann und Enkelsohn, der seine Oma immer dafür liebte, vor den Schlägen des Vaters und den Gemeinheiten der Mutter beschützt und von ihr umsorgt zu werden.
Liebe oder Hass sind eben relative Größen, gegen welche die Vernunft häufig wenig auszurichten hat. Genauso wenig wie gegen Habsucht oder Verantwortung seiner Vergangenheit gegenüber.
„Das offene Meer gehört allen […] es gibt auf ihm keine Landesgrenzen! Man kann es nicht erobern wie eine Kolonie! Es ist der freieste Ort auf der Welt.“ Mit diesen Worten richtet sich in der Erzählung Lignum vitae ein kleiner Schiffsjunge auf der Brigg Mary Mallory gegen den Matrosen Peterson und seine Aussage, dass auf offenem Meer alle Gefangene seien. Ein- und derselbe Ort kann Erfüllung oder Einschränkung bedeuten, Glück oder Unheil. Für den Schiffsjungen beinhaltet die Fahrt auf diesem Schiff die Aufgabe, den heimlich an Bord mit seinen Chronometern hantierenden Mr. Harrison zu beschützen, einen Kontrahenten Isaac Newtons.
Von zwischenmenschlichen Abhängigkeiten wissen Matilda und Silke in Chain Gang eine Geschichte zu erzählen, befinden sie sich doch, durch Handschellen dauerhaft verbunden, in einem autoritären Frauengefängnis, wo sie Sinnsprüche auf Wandbilder sticken müssen – gleichzeitig. Abhängig sind sie jedoch, wie der zweite Blick zeigt, weniger voneinander als von der sadistischen Aufseherin Frau Stipkowitz, deren Ermordung durch die beiden Damen, die einander als Zeuginnen dienen, sich schwer beweisen lässt.
Die Geschichten in diesem Band sind – auch sprachlich – vielfältig, detailgenau und tragikomisch. Sie erzählen von Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind, von innerer Freiheit bei körperlicher Gefangenschaft und innerlicher Gefangenschaft in Freiheit.