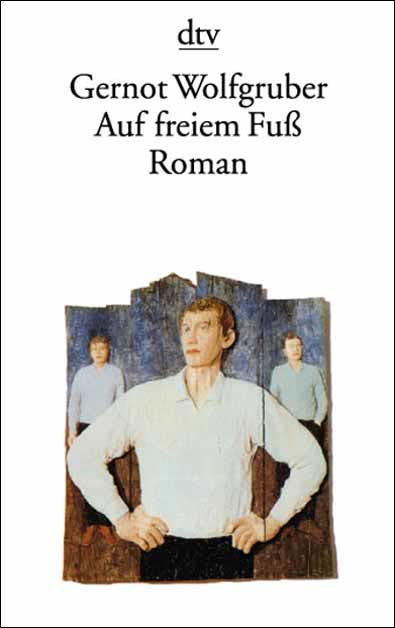Rasch eignet sich der Ich-Erzähler die nötigen Gesten an, die es ihm erlauben, sich in den monotonen Arbeitsprozess einzugliedern. Zugleich aber erkennt er, dass er sein Brot nicht nur im sprichwörtlichen Schweiße seines Angesichts zu verdienen, sondern sich zudem gegen die Schikanen seiner Vorgesetzten zu wehren hat. Als er dem Druck in der Fabrik nicht mehr standhält, kündigt er. Ein neuerlicher Anlauf als Lehrling in einer Glasfabrik scheitert ebenso kläglich. Erst nachdem er in einer Setzerei zu arbeiten beginnt, scheint er bereit, sich seinem Schicksal zu fügen. Doch dann gerät er auf die schiefe Bahn: Der Roman endet mit seiner Entlassung aus der Strafanstalt und der Rückkehr in eine zweifelhafte Freiheit.
Wolfgruber beschreibt in der schmucklosen, derben Sprache des Arbeitermilieus, wie sich vor dem Hintergrund von Langeweile und Hoffnungslosigkeit allmählich Veränderungen in der Psyche seines Protagonisten vollziehen. Er zeigt das vergebliche Trachten junger Männer, sich jenseits der von Gehorsam und Unterdrückung geprägten Welt der Erwachsenen ein humanes Dasein zu schaffen, in dem Selbstverwirklichung und Freude nicht als eitle Grillen abgetan werden. Zwischen romantischem Überschwang und pubertärer Rebellion schwankend, greifen sie dabei unweigerlich auf überkommene Muster einer patriarchalen Kultur zurück, wobei rüde Männlichkeitsrituale wenigstens für Augenblicke die tristen Lebensverhältnisse vergessen machen sollen. So treffen sich die Halbwüchsigen in ihrer kargen Freizeit, um Strategien gegen Frustration und Unsicherheit zu erproben. Alle wollen sie „klasse Typen“ sein, und wer sich durch besondere Mutproben auszeichnet, steigt im Ansehen der Clique. Solcherart ‚motiviert‘ werden Einbrüche verübt, die immer dreistere Formen annehmen. Diese metaphorischen Ausbruchsversuche werden, sobald die Justiz auf den Plan tritt, ad absurdum geführt. Die Verhaftung des Ich-Erzählers wegen Kleindelikten und die über ihn verhängte Kerkerstrafe inklusive Einzelhaft zeigen einmal mehr die Ironie jeglichen autoritären Systems, das gemäß seiner inhärenten Dialektik auf Unterwerfung zielt und doch stets ihr Gegenteil bewirkt.
Das von Wolfgruber emotionslos und luzid gezeichnete Bild einer Gesellschaftsordnung, die Österreich bis zur Klimax von 1968 dominierte, erstickt nicht zuletzt aufgrund ihres Autoritarismus jeglichen Anflug von Nostalgie im Keim. In diesem Roman, der keine Sieger, sondern nur Geschlagene kennt, wälzt jeder als Sisyphos seinen Felsen den Hang hinauf. Eingespannt in das Räderwerk einer versteinerten Hierarchie reduziert sich der Spielraum des Individuums auf ein Minimum. Wer wie Wolfgrubers tragische Figuren noch einen Funken Leben in sich trägt, muss unweigerlich die Frage nach der Berechtigung dieser als unmenschlich empfundenen Entmündigung stellen.
Mögen inzwischen die Methoden der Unterdrückung und Manipulation auch subtiler geworden sein, so besteht doch kein Zweifel darüber, dass Auf freiem Fuß heutige Leser anzusprechen vermag. Zwar versteckt sich die Entfremdung in der so genannten modernen Arbeitswelt hinter einem humaneren Antlitz, aber dieses nagende Gefühl, dass das Leben woanders stattfindet, lässt auch kaum einen von uns Heutigen los.
Der von Wolfgruber beschriebene Mikrokosmos des verachteten, ja getretenen Lehrlings mag uns obsolet anmuten, dennoch verweigert sich Auf freiem Fuß einer neuen, zeitgemäßen Lesart keineswegs. Dieser engagierte Text offenbart exemplarisch die Dynamik und Historizität von Rezeption, erkennen wir uns doch im Protagonisten trotz der geänderten Lebensbedingungen wieder.
Die von Jung und Jung besorgte Neuauflage ist gewiss als Glücksfall zu werten, weil sie uns ein Stück Literatur in Erinnerung ruft, das – vom Besonderen aufs Allgemeine verweisend – zeitlose Gültigkeit und also Lesbarkeit beansprucht.