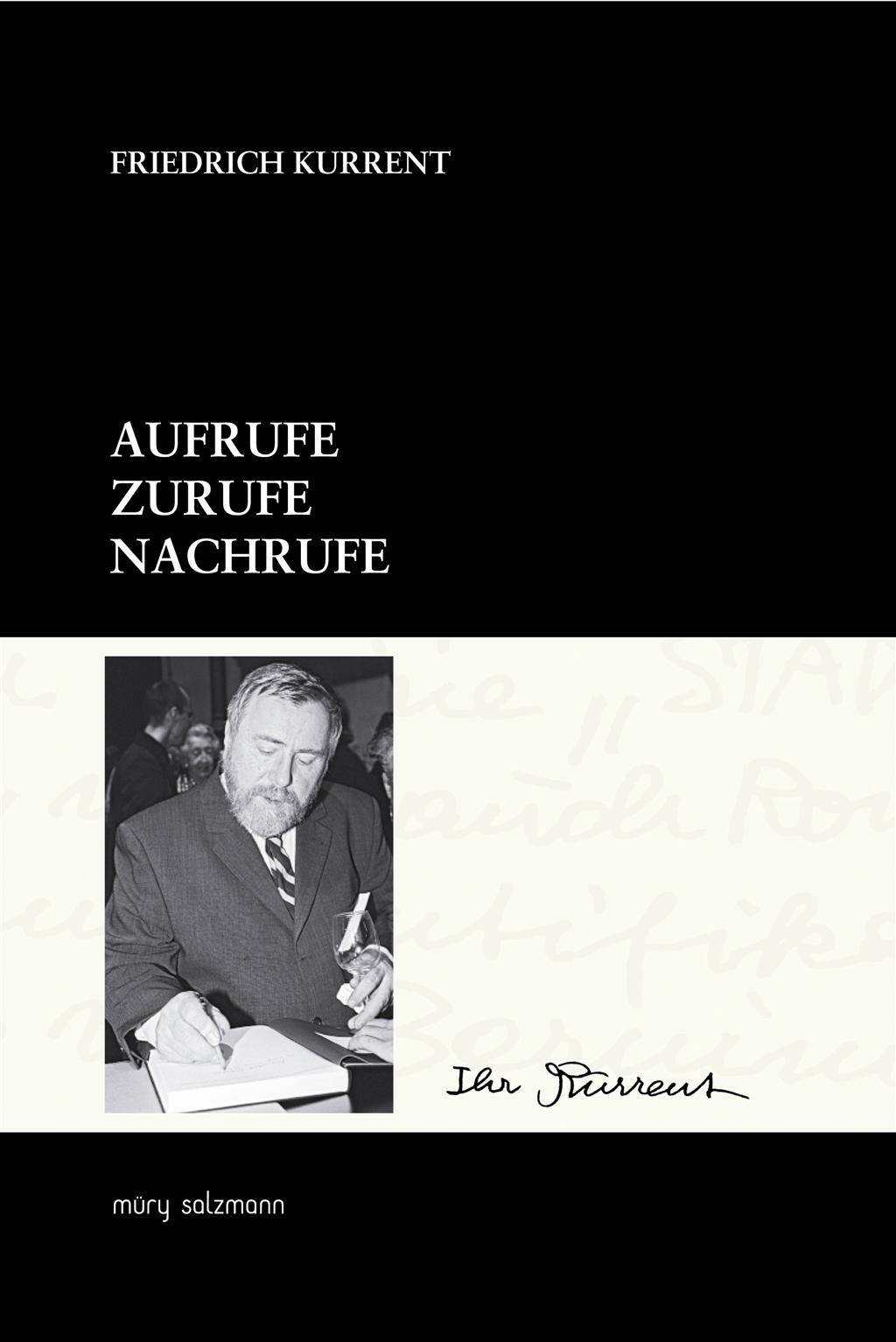In Achleitners Kompendium geschieht auch für die Aufarbeitung anderer Kunstsparten Exemplarisches: Aufgelistet werden die Auftraggeber, die BauherrIn, die Planenden und die Ausführenden; einem Bild steht jeweils eine kurze aktuelle, aber historisch verankerte Beschreibung gegenüber. Kulturgeschichtliche Bezüge und Verwandtschaften werden erwähnt, bauliche Besonderheiten und biographische Verquickungen hervorgehoben. Immer wieder nimmt er Bezug auf Vorurteile und Zeitströmungen, auf regionale Eigenheiten, oder geht auf die Verwendung von Begriffen wie Reihenhaus, Bassenahaus, Stadtvilla, Doppeltrakter ein.
Die literarische Qualität des Autors – der für sich selbst die Bereiche Architektur und Literatur getrennt sieht – macht die kurzen Texte trotz ihrer Dichte lesbar und kunstvoll. Friedrich Achleitner ist auch als Architekturschriftsteller ein Sprachbeherrscher. Mit ein bisschen Imagination kann man sich lesend ein vergangenes Kulturleben vor Augen zaubern, wenn man das Haus des ehemaligen ersten Stadlauer Kino-Theaters besucht oder die ehemalige Stadlauer Likörfabrik.
Als Desiderat bleibt die bislang unerforschten Geschichte der Baufirmen, aus der noch eine ganz andere, besondere Baugeschichte Österreichs entstehen könnte.
Friedrich Kurrent Aufrufe, Zurufe, Nachrufe
„Die vorliegende Textsammlung Aufrufe, Zurufe, Nachrufe bildet mit den 2006 im Verlag Anton Pustet erschienen Texten zur Architektur ein komplementäres Paar“, zusammen mit den ebenfalls bei Pustet erschienen Städtezeichnungen (1999) und der Werkmonografie Einige Häuser, Kirchen und Dergleichen (2001) „sind nun wesentliche Facetten des kurrentschen Schaffens dokumentiert – das bauliche, das zeichnerische, das schriftliche“, schreibt die Herausgeberin Gabriele Kaiser im knappen Vorwort.
Friedrich Kurrent selbst widmet die hier versammelten Texte „Meinen Freunden und Freundinnen – den Lebenden und den Toten“, ein Zeichen der Verbundenheit zur Architektur- und Kunstszene der Gegenwart, und seiner Wertschätzung für das Werk anderer, die ihn letztlich nicht zum ausschließlichen Schöpfer, sondern auch zum Begleiter des Schaffens anderer werden ließ. Kurrent war, nach seiner „Hochzeit“ als Mitglied der Architekturgruppe Dreiviertler, jahrzehntelang als Universitätslehrer Mittler der Architekturkunst; er nimmt Anteil, er ist dabei, wenn Kunst besprochen und präsentiert wird, er führt Gespräche, plant, versucht ans Licht zu bringen, wachzurütteln, er mischt sich ein und regt an.
Kennt man die künstlerischen Kreise, in denen Kurrent tätig ist, dann ahnt man, auf welche Widerstände er bei seiner Arbeiten immer wieder stößt – etwa, als er anregte, ein Plischke-Haus in Graz unter Denkmalschutz zu stellen oder als er versuchte, eine Ausstellung über die Familie Praun zu initiieren. Die Texte des Bandes zeigen die Etappen in Kurrents freundschaftlich-künstlerisch-wertschätzenden Beziehungen. Und er fordert immer zum genauen Sehen auf, ein Sehen das Wissen erfordert. Notfalls schreibt er auf Briefe an die Regierenden, wie den abgedruckten an Angela Merkel mit einem Plädoyer für den Erhalt des Palasts der Republik.
Er schreibt über die Freilegung des Innenraumes der Stallburg, da ist der gewonnene Kampf um das Semper-Depot, seit vielen Jahren Schauplatz von Theaterveranstaltungen und Ausstellungen, und es gibt auch viele verlorene Kämpfe um Bauten, die Entwürfe geblieben sind. Ihn interessieren die Holzböden der Albertina, die er zeichnend wahrnimmt, aber auch der Kunden- und SammlerInnenkreis oder das Arbeitsfeld jener, die sich um „anonyme Architektur“ kümmern wie das Ehepaar Windprechtinger. Immer aber ist er im Zentrum des Geschehens: als Bewohner des Spittelbergs, als Zeitgenosse der AuftraggeberInnen und NutznießerInnen.
Zwar gilt der Architektur Kurrents Hauptaugenmerk, aber es gibt unter den Texten, die oft Nachrufe, Laudationes oder Glückwünsche sind, auch Persönlichkeiten der Literatur, der Malerei und anderer Künsten, nicht selten sind es Querdenker und produktive Störenfriede. So sind Nachruf und Grabrede auf den 2004 verstorbenen Michael Guttenbrunner ebenso in den Band aufgenommen worden wie sein Augenzeugenbericht über den Eklat bei der Verleihung des Staatspreises an Thomas Bernhard 1967; Würdigungen zu Paul Parin, Wieland Schmied, Bogdan Bogdanovic, Josef Mikl oder Margarethe Schütte-Lihotzky finden sich genauso wie zu Peter Kubelka und Friedrich Achleitner – mit dem vereint finden wir Friedrich Kurrent auch im Faksimile (S. 10) der letzten Seite des von H. C. Artmann verfassten Manifests vom 17. Mai 1955 gegen die Wiedereinführung des Bundesheeres und die Wiederbewaffnung Österreichs. Und in der Beschreibung „Fest am Spittelberg“ zu Achleitners Hochzeit im Jahr 1962 lässt er die ist die gesamte Wiener Szene auftreten, bis hin zu Otto Kobalek aus dem Kreis um Joe Berger. Ein Personenregister freilich fehlt schmerzlich.