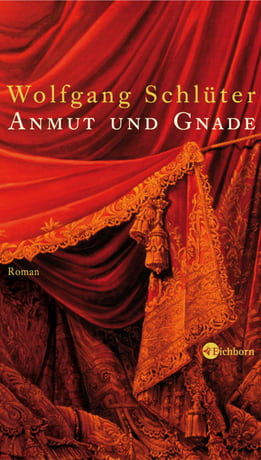Dieser Roman ist komplex und vielstimmig orchestriert und motivisch in vielen kleinen Details vernetzt, elegant, verspielt und subtil ausgestaltet, und doch bleibt manches diffus, wo anderes wieder in scharfen Konturen hervortritt wie aus dem Nebel einer vergangenen Epoche, als „Grâce“ noch ein gesellschaftlicher Wert war. Zwischen zwei Zeitebenen springt der Text: Da das Paris des Jahres 2003 mit seinen Unruhen in den Banlieues, da das vorrevolutionäre Paris der Enzyklopädisten und der Opernstreit zwischen Neuerern und Fundamentalisten. Was diese Zeitebenen verbindet ist Jean-Philippe Rameau und seine Ballettoper „Les Indes galantes“. Diese, ein Erfolgsstück Rameaus, dann über zweieinhalb Jahrhunderte vergessen, wird von einem österreichischen Ensemble für alte Musik unter einem gewissen Erlmayr in Paris in historisch originaler Aufführungspraxis eingespielt. Der Pressereferent des Orchesters ist der Ich-Erzähler Walter Mardtner. Ihm fällt ein Konvolut von Texten, Notaten, Skizzen und Partiturstücken eines Jean Devin in die Hände; oder besser: es wird ihm zugespielt von einem verschmitzten jüdischen Buchhändler.
Das ist gewissermaßen die Jean Paulsche Komponente; aber es gibt auch die einer schwarzen Romantik à la E.T.A. Hoffmann: Da huscht ein Widergänger Rousseaus durch die Gassen von Paris, da liegt Mardtner mit Fieberschüben und wilden Phantasien im Hotelzimmer, aber im Gegensatz zu Schlüters vorangegangenem Roman „Dufays Requiem“ wird der Musik hier nicht eine zerstörerische und diabolische Macht zugeschrieben, sondern eine der Verzückung und Ekstase. Beides passt nicht in den Kreis der Aufklärer, und so wird nun auch heftig diskutiert und gestritten: Voltaire, Diderot, d’Alembert, Rousseau, Rameau und ihre Mäzene und die Damen der Salons – in konstanter Schnitttechnik die Zeitebenen hart gegeneinander setzend, lässt Schlüter sie alle zu Wort kommen, oft im Originalton und mit allen Eigentümlichkeiten. Zusätzlich kontrastiert er diese Stimmlagen auch optisch durch die phonetische Wiedergabe oder den mäkelnden Stil, durch die Fabulierlust und durch nachempfindende Imaginationen Mardtners.
Nicht nur, dass Schlüter formal die Entrees und Tableaus der Oper imitiert, er geht gewissermaßen auch mit der die Schärfen und Gegensätze herausarbeitenden historischen Aufführungspraxis etwa eines Nikolaus Harnoncourt vor; und dieser ist es auch, der im Roman als der Dirigent Erlmayer im O-Ton hörbar wird in jenen Szenen, in denen Mardtner den Aufnahmen des Orchesters beiwohnt. Einmal lässt ihn der Autor quasi sich selbst zitieren; Erlmayer: „Der Harnoncourt hat mal gesagt: Unmöglichkeiten sind die schönsten Möglichkeiten“ (S. 61) und gibt damit auch den Titel von Sabine M. Grubers Buch mit Harnoncourt-Probenzitaten wieder. Schlüter imitiert damit eine Idee von Authentizität, er tut dies aber auf eine verspielte und kuriose Weise, indem er auch anachronistisches Vokabular untermischt, und zwar in beide Richtungen: Mardtner spricht in einem kultivierten, aber hundert Jahre alten Deutsch, während in das Parlieren der theoretisierenden Pariser Elite um 1750 auch unbekümmert Ausdrücke wie „kulturelles Gedächtnis“ oder „Schläfer“ (für potentielle Attentäter) einfließen.
Wie Rameau, der berühmt ist für seine Klangmalerei und die Farbigkeit der Orchestrierung (etwa in den Geigen im Schlusschor des Prologs „traversez – überquert die Meere“, und „volez – fliegt zu den fernsten Gestaden“) geht Schlüter lautmalerisch vor. „Les Indes galantes“ zeigt in vier Akten vier Völker – Beispiele für das Gute und den edlen Wilden im Rousseauschen Sinn, wie er nur zu finden ist außerhalb Europas, und gibt damit eine indirekte Kritik seiner Zeit. Wie Fuzelier, der Librettist dieser Oper, Quellen anführt, um der Handlung mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, wie Rameau Dudelsäcke und exotische Harmonien in seine Tanzformen einbezieht, montiert Schlüter Dokumente und Originalzitate einer bereits exotischen Vergangenheit in den Text, wie dort wird auch bei Schlüter die herrschende Epoche mit einem Gegenbild kritisiert, und wie Rameaus Opernballett nicht abzielt auf eine durchgehende Handlung, sondern eher eine Revue an Orchester-Tänzen, Arien und Chorgesängen ansammelt, so stellt Schlüter seinen Roman als ein Textkompendium aus unterschiedlichen Formen zusammen.
Diese Zusammenstellung ist noch einmal gespiegelt in einer anderen musikalischen Form: dem Ricercar. Dieses gleicht dem Münchhausenschen Trick, sich am eigenen Zopf aus der Geschichte zu ziehen, indem sein Tun aus der Beschreibung dessen besteht, was als nächstes eintreten wird. Es ist Projektion und Vorvergangenheit, Futur exakt. Bei Schlüter sieht das so aus, dass angedeutet wird, der Text, in dem wir über die Auffindung dieses Konvoluts lesen, sei dieses Konvolut an Schriften, Notizen, Kommentaren und Notaten selbst. Jean Devin gibt es nicht; er ist eine Erfindung Mardtners, wie dieser, als Ich-Erzähler, wiederum nur eine Figur eines heimlichen auktorialen Erzählers ist, und so löst sich gewissermaßen alles in fiktionalen Spiegelungen auf. Dem gegenüber verankert sich die Erzählung mit dem O-Ton-Realismus der Erzählungen Erlmayrs/ Harnoncourts, die in Anschaulichkeit und vielfältigen Vergleichen nicht zu übertreffen sind. Dann ist da dieses kuriose und liebevoll geschilderte alte jüdische Emigrantenpaar. Ihnen gegenüber bleiben die historischen Figuren eher blasse Textorgane: Mit ein paar Ausrufen versehen wirken sie oft nur wie Zitatträger, und wenn Schlüter dabei das „französelnde“ Deutsch des Berliner oder Wiener Hofs einsetzt, so ist das nicht unbedingt der passende Versuch von Adäquation.
Problematisch ist der Roman, was die Darstellung der Unruhen in Paris betrifft, in realpolitischer Hinsicht; aus der Perspektive eines Operndiskutanten bleibt dieser Aufruhr unverständlich und in seinen sozialen Ursachen und Hintergründen unreflektiert. Die Brandstiftungen hier mit einem geplanten Brand-Attentat auf den König in der Pariser Oper zu parallelisieren, ist ein Versuch, der an Canettis „Blendung“ erinnert, in der Privates und Politisches ebenfalls in einem Brandbild zusammengeführt werden. Gerade mit diesem Beispiel kann Schlüter den bitteren, aber unspezifischen Kulturpessimismus nicht belegen, und der Rückwärtsblick wird zu einem anderen „Indes galantes“, als Ideologie und Traum einer Epoche, in der die Pariser Oper von der geistigen und politischen Elite in theoretischen Schriften und in den Salons heftig umstritten wurde, aber nicht in Straßenschlachten arbeits- und perspektiveloser jugendlicher Zuwanderer.
Mit seinem Roman hat Schlüter dennoch gleich zwei Ziele erreicht: Er gestaltet artistisch und auf höchstem Sprachniveau, und er verführt zur Musik; wer den Roman liest, wird auch die Oper hören wollen. Im Nachwort verweist der Autor auf eine Einspielung, und hält hier noch eine Überraschung parat: Nicht Erlmayr/ Harnoncourt und dessen „Concentus Musicus“ haben die beschriebenen Aufnahmen im September 2003 gemacht, sondern William Christie mit seinem Ensemble „Les Arts Florrisants“. Wie sehr das Buch eine Hommage darstellt an die Beseligung durch diese Musik, an ihre Anmut und Gnade, das wird spätestens erfahrbar im letzten „Entrée“ des Romans. Erst hier schließt sich das polyphone Erzählkonstrukt, kommen Gegenwart und Geschichte zusammen im Bild von Autodafés, Brandanschlägen und der Aufführung der Oper, während draußen die Straßenschlachten toben. Schlüter antwortet hier leise wie aus dem Off auf die Frage nach dem Verbindenden aller Kunst: „Noch einmal rufts fragend aus dem Nebenraum: ‚Wie gelänge mir eine gute Opéra, Maître?‘ Rameau flüstert, wie zu sich selbst: ‚Mon ami, faites-moi pleurer.'“